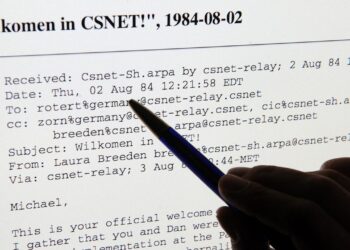NS-Verbrechen und SED-Diktatur Regierung beschließt neues Gedenkstättenkonzept
Stand: 12.11.2025 16:34 Uhr
Weniger Zeitzeugen, marode Gedenkstätten: Um darauf zu reagieren, hat die Bundesregierung ein neues Konzept für die Erinnerung an NS-Verbrechen und die SED-Diktatur verabschiedet. Der deutsche Kolonialismus ist nicht Teil davon.
Die Erinnerung an die NS-Zeit und die DDR-Diktatur soll zeitgemäßer werden. Die Bundesregierung hat ihr Gedenkstättenkonzept aktualisiert. Das Bundeskabinett billigte die knapp 50 Seiten starke Konzeption des Bundes von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
In den vergangenen Jahren berichteten vor allem Zeitzeugen von ihrem Leben und ihren Erfahrungen, doch die Zahl derjenigen, die aus eigener Erfahrung berichten können, nimmt stetig ab. Nun soll die Digitalisierung zur Hilfe kommen – etwa durch Hologramme von Zeitzeugen. Die Bundesregierung will außerdem Podcasts, Social-Media-Projekte oder digitale Archive fördern. Weitere Schwerpunkte sind der Erhalt der historischen Orte, also die Sicherung und Sanierung der Gedenkstätten, und die Vermittlung und Forschung durch neue Ausstellungsformen.
Die SED-Opferbeauftragte des Bundestags Evelyn Zupke, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Uwe Neumärker präsentieren das neue Konzept.
„Stärken die Erinnerung die Opfer“
Gedenkstätten seien „Teil der kritischen Infrastruktur unserer Demokratie“, erklärte die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke. „Mit der neuen Gedenkstättenkonzeption stärken wir die Erinnerung an die Opfer und schlagen zugleich eine Brücke zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart durch eine Stärkung der Vermittlungsarbeit, insbesondere auch im digitalen Raum.“
Auch der parteilose Minister Weimer betonte die Bedeutung der Erinnerungsarbeit.
Deutschland trägt eine immerwährende Verantwortung, an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern und der Opfer zu gedenken. Zugleich gilt es, das SED Unrecht energisch aufzuarbeiten.
Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister
Wachsende Anfeindungen, marode Gedenkstätten
In dem Konzept wird auf wachsende Anfeindungen gegen NS-Gedenkstätten hingewiesen. Deren Arbeit werde infrage gestellt, historische Fakten würden geleugnet, Mitarbeiter verunsichert oder bedroht. Die Erinnerung an die Schoa, an die Staatsverbrechen und staatliches Unrecht müsse gegen verleugnende oder revisionistische Tendenzen verteidigt werden, heißt es.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte das überarbeitete Konzept als „ein wichtiges und ein notwendiges Zeichen“. Der klare Fokus auf die Verbrechen der NS-Diktatur sende „angesichts der aktuellen Herausforderungen und der Bedrohung jüdischen Lebens durch den wieder aufkeimenden Antisemitismus das richtige Signal“.
Doch viele der Gedenkorte sind baulich in einem schlechten Zustand. Allein die KZ-Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen hätten einen Sanierungsbedarf von etwa 140 Millionen Euro, sagte Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Der Kulturstaatsminister sicherte zu, dass die Etats für Erinnerungskultur im kommenden Jahr erhöht würden. Zahlen nannte Weimer allerdings nicht.
Allein die KZ-Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen haben einen Sanierungsbedarf von etwa 140 Millionen Euro.
Deutscher Kolonialismus nicht Teil des Konzepts
Scharf abgegrenzt hat sich Weimer von Ideen seiner Vorgängerin Claudia Roth, auch Verbrechen des deutschen Kolonialismus in das Konzept aufzunehmen. Stattdessen werde ein separates Konzept entwickelt.
Der Linken-Abgeordnete Vinzenz Glaser kritisierte das deutlich: „Koloniale Gewalt und Rassismus sind Teil der deutschen Geschichte: Wer sie ausblendet, relativiert Verantwortung.“ Das neue Gedenkstättenkonzept sei deshalb ein „deutlicher Rückschritt im Verständnis deutscher Erinnerungskultur“.
Der deutsche Kolonialismus müsse als „dritte Säule der Erinnerungskultur verankert werden – ohne finanzielle Abstriche bei den anderen beiden Säulen“, forderte die Grünen-Kulturpolitikerin Marlene Schönberger in der Zeitung Welt.
Kommission geplant
Die Gedenkstättenkonzeption des Bundes wurde erstmals 1999 beschlossen und 2008 fortgeschrieben. Sie ist die Grundlage für die Förderung der Gedenkstätten an historischen Orten. Künftig soll eine Kommission Empfehlungen erarbeiten, welche Orte in die Förderung durch den Bund aufgenommen werden sollen.