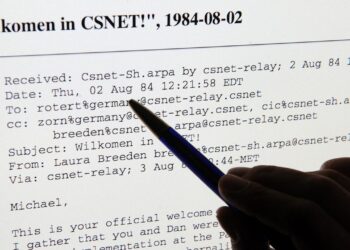analyse
Stand: 14.11.2025 19:07 Uhr
Wie kann die deutsche Stromversorgung zukünftig auch bei sogenannten Dunkelflauten gesichert werden? Die Koalition hat sich auf eine Kraftwerksstrategie verständigt. Aber die Einigung lässt viele Fragen offen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verkündete die Einigung zur Kraftwerksstrategie als eines der wichtigsten Ergebnisse des Koalitionsausschusses. „Diese Kraftwerksstrategie bedeutet, dass wir kurzfristig Anlagen ausschreiben, mit deren Hilfe rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit unser Stromversorgungssystem stabil gehalten werden kann“, so der Kanzler im Beisein der Koalitionsspitzen.
Das deutsche Stromsystem wird immer mehr auf erneuerbare Energien umgestellt. Windkraft- und Solaranlagen liefern über das Jahr inzwischen mehr als die Hälfte des Stroms. Aber je mehr Erneuerbare es gibt, desto größer wird das Problem der sogenannten Dunkelflauten. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, produzieren die Erneuerbaren sehr wenig Strom. Und weil die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und die Kohlemeiler ebenfalls schrittweise vom Netz gehen, braucht es Ersatz.
Reiches Pläne für Gaskraftwerken „gesundgeschrumpft“
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU wollte 20 Gigawatt an Gaskraftwerken hinzubauen. Das wären etwa 40 Kraftwerksblöcke. Aber nach dem Koalitionsausschuss ist erst mal nur von bis zu zwölf Gigawatt die Rede. Aus Sicht von Michael Kellner, dem energiepolitischen Sprecher der Grünen, wurden die viel zu großen Pläne von Wirtschaftsministerin Reiche „gesundgeschrumpft“, wie er sagt. „Brüssel hat offensichtlich gesagt, so geht das nicht. Und jetzt kommen da Pläne auf den Tisch, die ungefähr das sind, was Robert Habeck schon vorgeschlagen hatte.“
Habeck, der frühere Wirtschaftsminister von den Grünen, hielt den Zubau von Gaskraftwerken ebenfalls für unvermeidbar und verhandelte lange mit der EU-Kommission über die Details. Denn Brüssel muss zustimmen. Es geht dabei um Klimaschutzauflagen und um die Frage, inwieweit der Kraftwerksbau finanziell gefördert werden kann.
Brüssel muss Zubau noch zustimmen
Das Problem jetzt: Wirtschaftsministerin Reiche scheint sich ebenso wie ihr Vorgänger Habeck an Brüssel die Zähne auszubeißen. Es gibt immer noch keine Einigung mit der EU-Kommission. Timm Kehler vom Branchenverband der Gas- und Wasserstoffwirtschaft sieht deshalb noch keinen echten Durchbruch. „Die Investoren stochern im Nebel, wir sehen noch nicht, wie die Details ausformuliert sind“, so der Branchenvertreter. „Damit können Investoren derzeit noch nicht klar bestimmen, wann welche Kraftwerkskapazitäten gebaut werden sollen.“
Tatsächlich verzögert sich der Zeitplan immer mehr. Selbst im Fall einer schnellen Einigung mit Brüssel – die von der Bundesregierung in Aussicht gestellt wird – dürften die ersten Ausschreibungen kaum vor dem Sommer nächsten Jahres erfolgen. 2031 könnten dann die ersten Kraftwerksblöcke stehen.
SPD: Ausbau der Erneuerbaren nicht ausbremsen
Aus Sicht der Gasbranche braucht es langfristig sowieso mehr neue Kraftwerke als die jetzt angepeilten. Die Bundesnetzagentur hat den Bedarf an steuerbarer Kraftwerksleistung kürzlich erst in ihrem Bericht über die Versorgungssicherheit auf mehr als 22 Gigawatt beziffert. Ein Teil davon könnte allerdings auch über Speicher gedeckt werden. Einen Boom erleben derzeit insbesondere Batteriespeicher, die in der Regel allerdings nur kurzzeitig einspringen, nicht aber längere Dunkelflauten überbrücken können.
Aus Sicht der SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer darf die Kraftwerksstrategie nicht den Ausbau der Erneuerbaren ausbremsen oder dafür sorgen, dass noch über viele Jahrzehnte auf fossile, und damit klimaschädliche Gaskraftwerke gesetzt wird.
Die Koalitionseinigung betont daher, dass die neuen Gaskraftwerke wasserstofffähig sein müssen, also mittelfristig von Erdgas auf klimafreundlichen Wasserstoff umgestellt werden können. „Das ist wichtig, um keine Abhängigkeit von fossilen Ressourcen festzuschreiben“, betont die SPD-Politikerin. Nach dem Koalitionsausschuss gibt es bei dieser Frage eine Verständigung.
Finanzierung bleibt offen
Eine andere zentrale Frage bleibt aber ungeklärt: Wie sollen die Kraftwerke finanziert werden? Da sich Ersatzkraftwerke für Dunkelflauten am Markt kaum rechnen, braucht es wohl entweder Investitionszuschüsse oder eine garantierte Vergütung für die bereitgehaltene Kapazität.
Auch das sind Kosten der Energiewende. Wie das Modell genau aussehen soll, welchen Zuschüsse Brüssel am Ende zustimmt, ist nach dem Koalitionsausschuss nicht deutlicher geworden. Am Ende dürfte der Erfolg der Kraftwerksstrategie vor allem am Geld hängen.