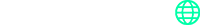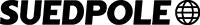Kibbuz zwei Jahre nach Angriff „Es ist traumatisch, hier zu wohnen“
Stand: 07.10.2025 07:19 Uhr
Er überlebte, weil er sich im Schutzraum versteckte. Seine Nachbarn wurden ermordet. Um den Terrorangriff der Hamas vor zwei Jahren zu verarbeiten, führt Ralph Levinson Besucher durch seinen leeren Kibbuz.

Ralph Levinson begrüßt die kleine Besuchergruppe aus Michigan in den USA. Er steht im Zentrum des Kibbuz Kfar Aza – in dem, was davon noch übrig ist. Manche Gebäude sind ausgebrannt, andere voller Einschusslöcher. Kfar Aza ist auch zwei Jahre nach der Terrorattacke der Hamas weitgehend verlassen.
„Hier ist nichts mehr“, sagt Ralph Levinson.
„Hier ist nichts mehr“
Levinson, der als Kind in Namibia deutschsprachig aufwuchs und vor 55 Jahren in den direkt am Gazastreifen gelegenen Kibbuz zog, denkt an das Gemeinschaftsleben zurück, das es jetzt so nicht mehr gibt: „Von 100 Prozent auf null. Hier ist nichts mehr – kein Laden, keine Klinik, kein Busverkehr. Deshalb ist es sehr schwierig, hier zu wohnen. Auch Kinder wohnen hier nicht mehr.“
Schon kurze Zeit nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 begann Levinson, Besuchergruppen durch Kfar Aza zu führen. In weiten Teilen ist es eine Führung durch eine Geisterstadt.
Im Schutzraum überlebt
An den Türen der beschädigten Häuser sind Zahlen aufgesprüht. Es sind die Zahlen der Toten, die die Ersthelfer damals dort fanden. Levinson hält an einem dieser Häuser, wo eine ganze Familie ermordet wurde.
Er selbst hatte am Tag der Attacke schlichtweg Glück. Terroristen der Hamas ermordeten seine Nachbarn, sein Haus wurde verschont. Er überlebte im Schutzraum, wo er mehr als einen Tag lang mit seiner Frau ausharrte.
Angst vor dem Zurückkommen
Derzeit lebt der 73-Jährige in einem Kibbuz, etwa 25 Kilometer von Kfar Aza entfernt. Er zögert, zurückzukommen.
Ich war schon bereit herzukommen, aber meine Frau nicht. Es ist sehr einsam hier. Es sind ganze Reihen von Häusern, wo kein Mensch wohnt. Wo man denkt, der wurde hier ermordet, der wurde hier ermordet, und die wurde dort vergewaltigt, und hier ist das Haus total weggespült worden. Es ist ziemlich traumatisch, hier zu wohnen. Und es knallt natürlich heftig hier. Vor allem nachts.
Dauerbombardement im benachbarten Gazastreifen
Auch während des Rundgangs mit der Besuchergruppe aus Michigan ist das Bombardement im Gazastreifen, nur wenige Kilometer vom Kibbuz entfernt, zu hören.
Levinson beruhigt die Gruppe. Sie hätten nichts zu befürchten. Es sei die israelische Armee, die feuert, sagt er.
Das Bombardement im Gazastreifen hält seit zwei Jahren an. Ein Lebensraum für zwei Millionen Palästinenser ist weitgehend zerstört. Zehntausende wurden getötet, Hunderttausende sind auf der Flucht.
„Es ist eine ganz brutale Kultur“
Levinsons Mitleid mit seinen palästinensischen Nachbarn hält sich in Grenzen. Zu stark sind für ihn die Erinnerungen an den 7. Oktober vor zwei Jahren.
„Ich habe schon gewisses Mitleid“, sagt er. Aber man dürfe nicht vergessen, dass es während des Terrorangriffs niemanden gegeben habe, der gesagt hätte: Nein, lass sie allein.
Alle haben auf sie eingeprügelt, gespuckt, auf sie eingeschlagen. Es gab durch die einheimische Bevölkerung nicht einen Versuch, die Geiseln freizulassen. Nicht einen Versuch. Es ist eine brutale, brutale Kultur. Eine ganz brutale Kultur.
Die Führung geht dann durch eine Straße, wo vor allem junge Leute lebten. Fast alle Häuser sind zerstört. Mehr als 60 Kibbuz-Bewohner wurden hier ermordet, andere entführt.
„Unglaublich, dass Menschen anderen so etwas antun können“
Eine Frau aus einem kleinen Dorf in Michigan ist zum ersten Mal in Israel. Levinsons Führung durch den Kibbuz erschüttert sie, macht sie nachdenklich: „Es war sehr bewegend, dieses Weinen zu hören, daran zu denken, dass hier so viele junge Menschen ihr Leben ließen. Unglaublich, dass Menschen in der Lage sind, anderen so etwas anzutun.“
Mit den Führungen durch seinen Kibbuz verarbeitet Ralph Levinson sein eigenes Trauma. Was aus Kfar Aza wird, wie sich der Kibbuz in Zukunft entwickeln wird, ist noch offen. „Leute wollen an jeder Wohnung, wo was passiert ist, ein Denkmal machen; andere sagen, wir wollen keine Denkmäler, wir wollen nicht auf einem Friedhof wohnen. Es ist sehr kompliziert, alles sehr emotional.“