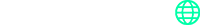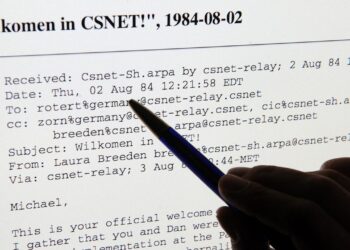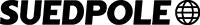Stand: 24.10.2025 08:11 Uhr
Frauen werden überproportional oft Opfer von partnerschaftlicher Gewalt. Die Täter sind meist männlich. Studien zeigen: Mehr Kommunikation über Gefühle und das Hinterfragen von Rollenbildern können helfen.
Alex ist Anfang 50 und verheiratet. Er hat einen sicheren Job und verdient gut. Eines Tages ist Alex gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden. „Wir haben uns gestritten, das war direkt an Weihnachten“, erzählt er und möchte dabei unerkannt bleiben. Es kommt zu einem Missverständnis, der Streit eskaliert. „Und dann habe ich sie gestellt und gepackt, so in der Halsgegend. Ich habe sie an die Wand gedrückt und gesagt: ‚Das lass ich mir nicht gefallen‘.“
Alex‘ Frau geht. Nach 18 Jahren Ehe verlässt sie ihn, zieht mit ihrer gemeinsamen Tochter aus und erstattet Anzeige. Alex sagt, er habe die Tat direkt danach bereut und nicht verstanden, weshalb seine Frau nun Angst vor ihm habe. Vor Gericht stellt er sie als psychisch krank dar. „Ich habe mich im Recht gefühlt. Total krass im Nachhinein für mich, wie ich damals drauf war“, schildert er.
So wie Alex‘ Frau geht es vielen Frauen. In Deutschland wird jede vierte Frau mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder ihren früheren Partner. Betroffen von partnerschaftlicher Gewalt sind zwar auch Männer, aber der Anteil weiblicher Opfer liegt höher – bei rund 80 Prozent.
Die Mär vom Testosteron
Lange galt die Annahme, dass Aggressivität in der Natur des Mannes liegt, dass das Hormon Testosteron, das für die Entwicklung der Sexualfunktion und das Muskelwachstum wichtig ist, dafür verantwortlich ist. Diese These kommt aus der Tierforschung: Experimente mit Tieren hatten gezeigt, dass bei kastrierten Tiermännchen die Aggressionen sanken. Die Rolle von Testosteron bei der Aggressionsentstehung wird aber schon seit Langem hinterfragt.
In einem Experiment mit 300 Männern und Frauen konnte der Psychologe Oliver Schultheiss von der Universität Erlangen-Nürnberg herausfinden, dass Testosteron keinen Einfluss darauf hat, ob jemand aggressiv reagiert. Dagegen war der Zusammenhang mit einem anderen Hormon zu beobachten: Cortisol. „Das Stresshormon, das der Körper normalerweise ausschüttet, wenn er in eine herausfordernde Situation kommt, und das normalerweise das Verhalten bremst und weniger impulsiv macht“, erklärt Schultheiss.
Der Cortisolspiegel war bei aggressiven Männern niedriger als bei den Personen, die nicht aggressiv wurden. „Und wenn mit meiner Stressreaktion was im Argen liegt, dann bin ich eher gewaltbereit.“
Die fehlende Kommunikation von Gefühlen führt zu Ohnmacht
Das Problem: Wer in der Kindheit oder später nie gelernt hat, seine Gefühle wahrzunehmen, zu erkennen und zu kommunizieren, kann in Konfliktsituationen das Gefühl von Ohnmacht bekommen. Und das kann zu Gewaltausübung führen, um vermeintlich die Kontrolle wiederzuerlangen.
Auch Alex kann das im Nachhinein bestätigen. Er hat nach seiner Tat eine Gruppe für Täter besucht. „Ich habe schnell gemerkt, dass mir das emotional sehr viel bringt. Einfach wie man über Konflikte redet. Ich habe ein Handwerkszeug gekriegt, das mir als Kind nicht mitgegeben wurde.“ Stattdessen gab es Schläge vom Vater.
Über Gefühle wurde nie gesprochen, erzählt er und das überforderte ihn noch Jahrzehnte später in seiner Ehe. „Wenn mir das zu belastend wurde, was mir meine Frau vorgeworfen hat oder ich mich zu hilflos gefühlt habe, habe ich mich immer eingeigelt. Das war mein Reaktionsmuster.“ In der Täterarbeit lernt er zu kommunizieren, was in ihm vorgeht.
Gewaltausübung: Macht, Abwertung und Erniedrigung
Die meisten gewalttätigen Männer kämen, weil sie entweder vom Jugendamt oder der Staatsanwaltschaft geschickt wurden, erklärt der Sozialpädagoge Simon Tica. Er leitet eine Tätergruppe. In vielen Gesprächen erkennt er ein Muster: „Das Drumherum spielt immer eine große Rolle“. Die Männer würden eine Geschichte aufbauen, in der die Frau schlussendlich die Situation provoziert hätte, weil sie „streitet ja auch so heftig und lässt mich nicht in Ruhe“.
Und Stereotype spielten oft eine Rolle, erklärt Simon Tica: „Der Mann muss stark sein oder der Mann ist das stärkere Geschlecht.“ Frauen hätten mittlerweile zu viel Macht in der Gesellschaft und bei Trennungen.
Frauenfeindliche Botschaften im Netz
Ein Narrativ, das auch Diplompädagoge Sebastian Tippe kennt. „Es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt“. Tippe gibt unter anderem Workshops an Schulen zu „feministischer Jungenarbeit“ und hat ein Buch zum Thema „Toxische Männlichkeit“ geschrieben.
Besonders in den sozialen Netzwerken wie TikTok, YouTube oder Reddit zeige sich eine besorgniserregende Entwicklung. Influencer wie Andrew Tate propagieren in der sogenannten Manosphere einfache Antworten zum Thema Rollenbilder, Männlichkeit und Selbstoptimierung.
„Viele Jungen identifizieren sich mit solchen Männern und lassen sich von deren misogynen Ideologie blenden und massiv beeinflussen“, erklärt Tippe. Sie sähen sich als Opfer von Frauen und Gleichberechtigung. Besonders radikal: Die Incel-Szene, in der Männer der Auffassung sind, dass sie ein Recht auf Frauen und auf Geschlechtsverkehr haben, und das auch mit Gewalt einfordern dürfen.
Die Vormachtstellung des Mannes ist ein Konstrukt
In den Netzwerken kursierten Rollenbilder, die angeblich einer natürlichen Ordnung entsprächen, erklärt die Politikwissenschaftlerin Ann-Kathrin Rothermel. Sie forscht zu Geschlechterrollen und Radikalisierung an der Universität Bern. „Das Problem dabei ist, dass die Männlichkeit, um die es da geht, als etwas Stabiles, als etwas Natürliches und Naturgebenes wahrgenommen wird. Das ist aber nicht der Fall. Männlichkeit hat sich über die Zeit immer gewandelt.“
Archäologische Funde legen nahe, dass Frauen und Männer in der Steinzeit gleichberechtigt in der Gemeinschaft Aufgaben wie zum Beispiel Jagen übernommen haben. Studien gehen davon aus, dass die Vormacht des Mannes erst mit dem Neolithikum, dem Beginn des Ackerbaus, oder sogar noch später ihren Anfang nimmt, also keineswegs naturgegeben ist.
Männer haben Angst vor Machtverlust
Der Abschied von alten Geschlechterrollen und Privilegien stelle für viele Männer eine Bedrohung dar. „Das führt dazu, dass die Idee entsteht, dass ich Menschen, die aus dieser natürlichen Ordnung ausbrechen wollen, abstrafen kann oder sogar muss, indem ich sie mit Gewalt, mit Worten, mit diskriminierenden Strukturen an ihren Platz zurückverweise“, so die Politikwissenschaftlerin Ann-Kathrin Rothermel.
Deshalb müsse sich, so der Diplompädagoge, Sebastian Tippe, gesamtgesellschaftlich vieles ändern, aber auch auf der individuellen Ebene: „Es fehlen den Kindern männliche Vorbilder, die ihnen ein differenziertes Bild von Männlichkeit transportieren“, so Tippe. Er fordert Prävention schon in der Schule mit Aufklärung über Gewalt, Frauengeschichte und Sexualität.
Aufklärung zu Rollenbildern schon im Kindesalter
Denn toxische Männlichkeit schade nicht nur Mädchen und Frauen. „Männer schaden sich auch massiv selbst“, so Diplompädagoge Tippe. „Aufgrund von problematischen Männlichkeitsvorstellungen und den daraus resultierenden Einstellungen und Verhaltensweisen sterben Männer fünf Jahre früher als Frauen.“