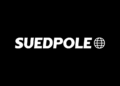Kray ist ein durchschnittlicher Stadtteil von Essen, vielleicht etwas ärmer als der Rest. Von vielen Wänden blättert die Farbe ab, die Rollos sind unten. Graffiti wie „Fick dich“, „Free Drugs“ oder „Leck meine Eier“ dominieren das Straßenbild. Die Nachbarschaft ist so „richtig ruhrpotterisch“, wie ein Anwohner sagt. Das heißt auch: Es liegt viel Müll auf der Straße rum, aber es gibt auch Menschen, die den Müll aufheben.
Das braune Holztor in der Marienstraße 66a sieht unscheinbar aus. Auf einem Papierzettel informieren die Bewohner des Vorderhauses, dass sie nicht Mitglied der Kleinstpartei „Die Heimat“ sind, die früher als NPD bekannt war. Wer zur „Heimat“ wolle, solle bitte schön in den Hinterhof. Dort befindet sich die Parteizentrale von Nordrhein-Westfalen. Die Nachbarn haben aus Protest bunte Wimpel an ihren Altbau gehängt. Ein laminierter Zettel warnt vor „herabfallenden Steinen“.
Die Anwohner stehen vor einer Frage, die immer mehr Menschen im ganzen Land beschäftigt: Wie geht man mit Rechtsextremisten in seinem Umfeld um? Ignoriert man sie, um sie nicht aufzuwerten? Oder wird man laut, um sich von ihnen zu distanzieren?
In Essen-Kray gibt es Ralf und Jörg. Ralf will das Ganze nicht größer machen, als es ist. Und Jörg will so laut sein wie möglich.
Bei jedem Treffen herrscht Ausnahmezustand
Seit dem Frühjahr kann es sein, dass Ralf jeden zweiten Freitag im Monat auf dem Heimweg einen kleinen Umweg fahren muss wegen der Straßensperren. Da finden in der Marienstraße nämlich Treffen der Parteijugend „Junge Nationalisten“ statt, kurz JN. Es sind „offene Abende“, offen für alle, außer „für Antifa, Presse & Co“, wie es heißt. Dann ist Ausnahmezustand in Kray.
Gegen fünf Uhr nachmittags rollen üblicherweise die ersten Polizeimannschaftswagen an. Polizisten zerren eine Straßensperre über den Asphalt. Vor dem braunen Holztor laufen breitschultrige Männer in schwarzen T-Shirts auf und ab, die Aufschrift weist sie als „Ordnungsdienst“ der rechtsextremen Partei aus.
Jörg ist da schon für die Gegendemo von „Essen stellt sich quer“ am Abend verabredet, einem Zusammenschluss zahlreicher Initiativen und Parteien wie den Grünen und der Linken. Viele Teilnehmer kommen von außerhalb des Stadtteils. Und dann gibt es noch eine Demo der „Antirassistischen Anwohner*innen Initiative“.
Ralf sagt, die ganze Polizei, die Straßensperren, das sei alles übertrieben „für die paar Leute da“. Die Rechtsextremen kenne er auch nicht aus dem Stadtteil. Ralf arbeitet in der Nähe der Marienstraße und steht den rechtsextremen Treffen in der Nachbarschaft gelassen gegenüber: „Für mich sind das sowieso nur Arbeitslose.“
Auch die beiden Trainer, die hinter ihm aus dem Vereinsheim treten, bekommen von den Rechtsextremen kaum etwas mit, außer dass sie wegen der Straßensperren etwas länger brauchen. Für Ralf sollte die Polizei nur zuschauen und erst eingreifen, wenn die Leute was kaputt machen.
Bis dahin gilt für ihn: beobachten, aber nicht aufwerten. Er sei selbst in seiner Jugend Hooligan gewesen, vor vierzig Jahren. Irgendwann fand er eine Freundin und hatte andere Dinge am Wochenende zu tun. Er wurde älter und reifer. In Kray haben manche die Sorge, dass die übrigen Probleme aus dem Blick geraten, wenn sich alle nur auf die Rechtsextremen konzentrieren.

Jörg sieht das anders. Er ist 62 Jahre alt und lebt seit 2008 in Kray. Wenn er mit seinem Hund unterwegs ist und Männer in Lonsdale-Shirts auf ihn zukommen, spürt er die gedrückte Stimmung im Stadtteil. Für ihn ist das kein Randproblem, sondern eine Gefahr, die an die Propaganda erinnert, die vor hundert Jahren verheerende Folgen hatte. Er geht zu den Demos, weil er später nicht gefragt werden will, warum er geschwiegen hat, als sich Nazis vor seiner Haustür trafen. Jörg liebt Kray, die Radtouren ins Grüne und den Biergarten „Wolperding“. Er will nicht, dass der Stadtteil als „Nazi-Kiez“ gilt.
Ein anderer Nachbar ist mit einer Kurdin verheiratet und erzählt, wie sie und die Kinder rassistisch beleidigt würden im Alltag, „auf dem Spielplatz, im Bus, beim Einkaufen“. Er spricht von einer „rassistischen Stimmung“ und will, dass die Parteizentrale geschlossen wird.
Kurz vor sieben Uhr trudeln die Teilnehmer ein. Es sind ungefähr 50, fast alle von außerhalb. Die meisten sind sehr jung, manche wirken, als hätten sie die Pubertät noch nicht erreicht, wenige Frauen sind dabei. Dann ziehen sie gegen Viertel vor neun los. Sie schreien: „Hier läuft der nationale Widerstand“ und „Deutschland den Deutschen“.
Hilft der Gegenprotest den Extremisten?
Im oberen Teil der Marienstraße stehen die Teilnehmer von „Essen stellt sich quer“. Solange die Rechtsextremen noch im Haus sind, sitzen sie hauptsächlich rum, trommeln, einer verteilt Rosen. Politisch stehen manche weit links, tragen schwarz und brüllen „Deutsches Blut auf deutschem Boden“ oder „Kein Vergeben, kein Vergessen – Nazis haben Namen und Adressen“.

Überall in der Straße schauen Menschen aus den Fenstern. Ein älterer Mann stützt sich auf sein Balkongitter, eingerahmt von roten Blumentöpfen. Die Rechtsextremen scheinen die Aufmerksamkeit zu genießen, auch den Protest. Hat Ralf also recht? Hilft der Protest den Extremisten?
Thomas Grumke von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen versteht die Reaktionen der Nachbarn, an der langfristigen Wirksamkeit von reflexhaften Gegendemos hat er aber Zweifel. Der Politikwissenschaftler sagt: „Beide Seiten ziehen daraus ihre Identität. Beide gehen nach Hause und sagen: Wir haben das Richtige getan, wir sind für unsere Sache auf die Barrikaden gegangen.“ In seine Seminare lade er regelmäßig Aussteiger aus der rechtsextremen Szene ein, für die Gegendemonstrationen früher geradezu ein Ansporn gewesen seien.

Irene Wollenberg sieht das anders. Die ältere Frau mit buntem Halstuch gehört zu den Frauen der ersten Stunde vom Bündnis „Steele bleibt bunt“, das ist ein anderer Stadtteil Essens. Dort haben sie gegen die „Steeler Jungs“ demonstriert, eine Art rechtsextreme Bürgerwehr. Wollenberg sagt: „Wir sind nicht die Störer, wir reagieren auf die Störer.“ Inzwischen haben die „Steeler Jungs“ schon lange keine Aufmärsche mehr veranstaltet, aber das Milieu ist weiterhin vorhanden. Wollenberg glaubt, dass der Protest die Zivilgesellschaft gestärkt hat.
In der Marienstraße könnte das auch so sein. Die Demo der Anwohnerinitiative hat 20 Teilnehmer und die andere 220. Die Zahl der Unterstützer ist aber größer. Eine junge Mutter bedankt sich über den Spielplatzzaun hinweg bei den Initiatoren. Ihre drei Jahre alte Tochter wurde auf dem Spielplatz als „kleine Ausländerin“ beleidigt. Demonstrieren möchte die junge Mutter nicht, aus Angst.
Die Rechtsextremen haben auch Sympathisanten. Eine andere junge Mutter raucht am Straßenrand, sie ist nur kurz in rosa Crocs aus ihrem Wohnblock gelaufen. Dem Aufzug stimmt sie inhaltlich zu, sie sorgt sich nur, dass ihre Kinder vom Lärm aufwachen. Es stimme ja, Deutschland sei überbevölkert. „Die Heimat“ wähle sie nicht, die hätten politisch zu wenig Einfluss. Sie wähle AfD.
Der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der „Heimat“-Partei, Claus Cremer, schwärmt in seiner Rede auf einer entfernten Kreuzung von der guten Nachbarschaft in der Marienstraße. Fast keiner habe ein Problem mit seinen Parteifreunden gehabt. Für einen zweiten Redner sind rechtsextreme Kundgebungen wie diese „ein normaler Freitagabend“. Von den Passanten, die vorbeieilen, widerspricht niemand. Nur die Gegendemonstranten tun es.
Später laufen vier von ihnen zur Bushaltestelle und werden von Rechtsextremen angegriffen. Die Polizei reagiert schnell, nimmt die Personalien von 19 mutmaßlichen Tätern auf. In einer Pressemitteilung berichtet die Linkspartei von den erheblichen psychischen Belastungen durch den Angriff. Auf Telegram kommentiert die „Heimat“, man solle „die Wehrhaftigkeit der deutschen Jugend halt nicht unterschätzen“.
Der Angriff bewegt auch den Oberbürgermeister dazu, sich öffentlich zu Wort zu melden. Er verurteilte die Gewalt und kündigte Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft an. Wie genau diese aussehen werden, steht noch nicht fest.