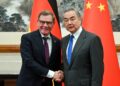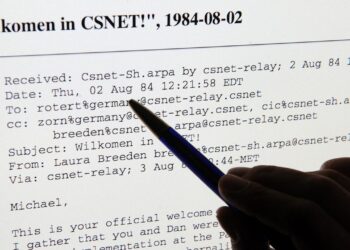Stand: 24.10.2025 03:46 Uhr
Satellitenbilder zeigen, der Ostflügel des Weißen Hauses ist nun abgerissen. Bald soll dort ein Ballsaal gebaut werden. Konservatoren und Traditionalisten sind empört. Trumps Ballsaal ist nicht sein einziges Bauprojekt, das in Washington für Diskussion sorgt.

Baustellen gibt es in Washington viele, doch an der 1600 Pennsylvania Avenue sind Abrissbagger selten zu hören. Gerade stand hier noch der East Wing des Weißen Hauses, nun soll ein Ballsaal entstehen: Für bis zu 1.000 Gäste auf mehr als 8.000 Quadratmetern, also fast doppelt so groß wie das Weiße Haus selbst.
Theodore Roosevelt ließ den ersten Ost-Flügel einst anbauen. Sein Nachfolger Taft setzte einen Tennisplatz daneben, Franklin D. Roosevelt einen unterirdischen Bunker darunter. Kennedy gestaltete das White House innen komplett neu. Doch Trumps Ballsaal würde das alles schon mit seiner Größe buchstäblich in den Schatten stellen, warnen Historiker und Denkmalschützer.
Der zuvor durch Trump plattgemachte Rasen im Rosengarten und das opulente Gold in seinem Oval Office kann man baulich verzeihen – weil man es rückgängig machen kann. Schließlich ist jeder Präsident nur ein Mieter auf Zeit. Doch der Fassadenabriss am East Wing sei destruktiv und respektlos, rufen TV-Kommentatoren in den USA. Der Präsident gewordene Bauunternehmer überschreite seine Kompetenzen.
Ohne öffentliche Mitbestimmung
Die Regierungssprecherin hingegen nennt das Projekt „mutig und notwendig“. Seit 150 Jahren, so Trumps Argument, wünschten sich Präsidenten und Mitarbeiter einen größeren Veranstaltungsraum, der zum Beispiel für Staatsbankette mehr Gäste aufnehmen kann, als der zurzeit genutzte East Room der Residenz. Bereits 2010 hatte Trump, damals noch als privater Geschäftsmann, dem Weißen Haus seine Idee mit der Ballsaal-Erweiterung zugeschickt, zusammen mit einem Spendenangebot über 100 Millionen US-Dollar. Doch vom damaligen Präsidenten Barack Obama bekam er nicht mal eine Antwort.
Nun schafft Trump Fakten – und zwar ohne öffentliche Mitbestimmung, kritisiert etwa der „National Trust for Historic Preservation“, eine gemeinnützige Organisation, die sich hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge finanziert. Bei der Umgestaltung des „People’s House“ haben die Volksvertreter im Kongress nichts mitzubestimmen, beklagen die Denkmalschützer. Es gibt kein Gesetzgebungsverfahren, kein formelles Votum.
Nicht mal die zuständige Aufsichtsbehörde kennt die konkreten Baupläne: Zwar soll die National Capital Planning Commission (NCPC) alle staatlichen Bauprojekte im Großraum Washington kontrollieren. Nach eigener Auslegung genehmigt sie aber lediglich Neubauten und Renovierungen, keinen vorbereitenden Abriss. Der Kommissionsvorsitzende ist ein Vertrauter Donald Trumps und sein Büro wegen des gegenwärtigen Shutdowns ohnehin geschlossen.
Wer genau das mit zunächst 250 Millionen US-Dollar kalkulierte Projekt finanziert, hat Trump bisher nicht verraten. Das Geld komme „von großzügigen Patrioten“, amerikanischen Unternehmen und von ihm selbst. Ohne Steuergelder, verspricht der Präsident. Das wäre allerdings illegal: Der „Antideficiency Act“ von 1982 verbietet der US-Regierung, öffentliche Projekte am Kongress vorbei mit privaten Geldern zu finanzieren – denn dieser Weg würde zum Beispiel während einer Haushaltssperre die Budgethoheit des Parlaments umgehen.
Weiteres Projekt in Planung: „Arc de Trump“
Und der Ballsaal ist nicht Trumps einziges Hauptstadtprojekt: Straßen und öffentliche Plätze in einem Radius von drei Meilen ums Weiße Haus sollen mit einem „Beautification“-Etat von zwei Milliarden US-Dollar saniert werden. Architektonisch müssen alle neuen Bundesgebäude in Washington auf Anordnung Trumps im streng neoklassizistischen Stil errichtet werden, modernistische Gebäude gibt es nur mit seiner Sondergenehmigung.
Und zum 250. Jahrestag der Staatsgründung im kommenden Sommer plant Trump einen 30 bis 50 Meter hohen Triumphbogen am Memorial Circle, vis-a-vis zum Lincoln Memorial. Auch an dessen Design ist der Präsident persönlich beteiligt, in Washington firmiert das Projekt bereits unter dem Namen „Arc de Trump“.