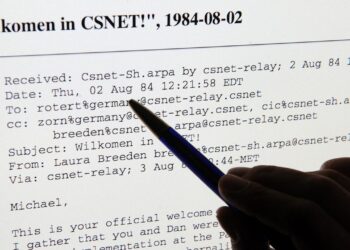Vogelwelt im Klimawandel Amsel, Drossel, Fink und Flamingo
Stand: 12.11.2025 03:30 Uhr
Die Amsel ist nach wie vor der häufigste Vogel in Deutschland, gefolgt von Buchfink und Kohlmeise. Doch in die Plätze dahinter kommt Bewegung – auch durch den Klimawandel.
Von Magdalena Schmude, WDR
Klein, rotbräunliches Gefieder, ein typischer, rhytmischer Gesang und in Deutschland auf dem Vormarsch: Der Seidensänger kommt eigentlich vor allem in Südeuropa vor. Durch den Klimawandel und die wärmeren Temperaturen dehnt sich sein Verbreitungsgebiet zuletzt aber immer weiter nach Norden aus.
Ähnliches gilt für den exotisch-bunten Bienenfresser, die Zwergohreule oder die Zaunammer. Und sogar einzelne Flamingo-Paare sind nach Deutschland eingewandert, die mittlerweile hier brüten. Das zeigt der Bericht „Bestandssituation der Vögel in Deutschland„, eine gemeinsame Publikation des Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA), des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW), der alle sechs Jahre die Lage der Vögel in Deutschland zusammenfasst.
Klare Trends erkennbar
Es sei das erste Mal, dass sich Bestandstrends bei einer Reihe von Vogelarten klar mit dem Klimawandel in Zusammenhang bringen lassen, sagt Tobias Erik Reiners, der Vorstandsvorsitzende des DDA. Während wärmeliebende Arten zahlenmäßig zunehmen, bekommen Arten, die gemäßigte Temperaturen bevorzugen, wie das Wintergoldhähnchen, zunehmend Probleme.
Ein weiteres Muster zeigt sich bei Vogelarten, die auf Feldern und im Grünland leben. Hier führen intensive Landwirtschaft und schrumpfende Lebensräume zu einem Rückgang vieler Arten, etwa bei Feldlerche und Bekassine. Insgesamt leben laut dem Bericht 304 Vogelarten in Deutschland, die hier regelmäßig brüten. Weitere 125 Arten rasten auf ihrer Reise von Norden nach Süden bei uns.
Gewinner und Verlierer
Neben den Neuzugängen aus dem Süden gibt es weitere Arten, die von langfristigen Umweltveränderungen profitieren. Dazu gehören Schwarz-, Bunt- und Mittelspecht, denen vor allem mehr Totholz im Wald einen Vorteil verschafft.
Umgekehrt macht der naturnähere Waldbau mit einem geringeren Nadelholzanteil Arten wie dem Tannenhäher und der Tannenmeise zu schaffen. Der Bericht zeigt aber auch, dass gezielte Schutzmaßnahmen helfen können, gefährdete Arten zu stabilisieren, wie etwa das Rebhuhn. Auch Großvogelarten wie der Uhu, der Kranich oder der Seeadler haben in den letzten Jahren von gezielten Artenhilfsprogrammen profitiert.
Umfassende Datengrundlage
Der Bericht basiert auf der Mitarbeit von 7.000 Freiwilligen, die sich am bundesweiten Vogelmonitoring beteiligen. Dazu kommen mehr als zehn Millionen Gelegenheitsbeobachtungen von mehr als 50.000 interessierten Laien, die auf einer Onlineplattform eingetragen wurden.