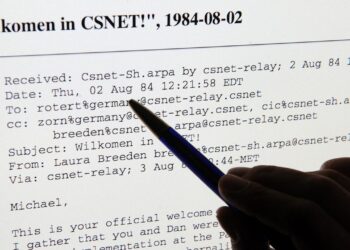weltspiegel
Stand: 09.11.2025 18:56 Uhr
Vor zehn Jahren wurden vor Guyana riesige Ölvorkommen entdeckt. Seitdem wächst die Ölindustrie rasant, boomt der Export. Doch die Armut ist noch lange nicht überwunden, und Sorgen vor den Umweltfolgen bleiben.
Wenn Umweltaktivistin Serlina Nageer mit dem Boot die Küste von Guyanas Hauptstadt Georgetown entlangfährt, sieht sie Kräne, soweit das Auge blicken kann. Die neue Skyline hier hat sich rasant gewandelt. Hotelhochburgen, riesige Tanker, Container. „Überall hier am Ufer waren Mangrovenwälder. Sie sind eigentlich gesetzlich geschützt, denn sie haben eine Menge CO2 gebunden.“
Und sie haben vor Überschwemmungen geschützt. Fast die gesamte Küste Guyanas liegt unterhalb des Meeresspiegels. 90 Prozent der Bevölkerung leben hier. Bis 2030 soll ein Großteil komplett unter Wasser stehen.
Hier, auf wenigen Quadratmetern Boot, zeigt sich, wie unterschiedlich das Öl gesehen wird, das der US-Konzern Exxon entdeckt hat. Für Bootsführer Dhanirem ist es – wie für viele Guyaner – ein Versprechen auf eine Zukunft in Wohlstand. „Das Öl ist wirklich gut für unser Land. Sehr, sehr gut. Wir haben diese Ressourcen und wir können sie fördern. Das schafft nur Exxon.“
Was wird der Ölboom den Menschen in Guyana bringen, und wie wird er das Land verändern? Die Erwartungen sind groß – das Wissen um die Risiken aber auch.
Das neue El Dorado der fossilen Energie
Guyana erlebt eine unglaubliche Verwandlung von einem der ärmsten Karibikstaaten zum neuen El Dorado der fossilen Energie. Mindestens elf Milliarden Barrel Öl, laut Exxon im Wert von mindestens 750 Milliarden US-Dollar, schlummern am Meeresgrund.
Kemraj Parsram, Regierungsvertreter und Direktor der Agentur für Umweltschutz, ist begeistert: „Mit den Ölinvestitionen haben wir unsere Wirtschaft vorangebracht, die Infrastruktur, Bildung und das Leben der Guyaner verbessert. Es ist eine gewaltige Entwicklung.“
Die Regierung hat unter anderem die Universitätskosten übernommen, studieren ist seit Anfang des Jahres kostenlos. Fraglich ist, ob die kostenlose Universität etwas an der aktuellen Arbeitssituation ändert.
Laut US-Außenministerium haben vergangenes Jahr 89 Prozent der Hochschulabsolventen Guyana verlassen. Zwei von fünf Guyanern leben im Ausland, während vor allem Einwanderer ins Land kommen.
Wirtschaftsexperte Christopher Ram analysiert: „Das Paradoxe ist doch, dass die Menschen immer noch gehen, wenn sie die Möglichkeiten haben. Der Ölboom kam so schnell, dass er unsere Wirtschaft, unsere Kapazitäten übersteigt.“
Investoren kommen, die Armut bleibt
Das schnellste Wirtschaftswachstum der Welt – es zieht internationale Investoren an. Den Demerara-Fluss überspannt eine neu eröffnete Brücke. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst – aus China.
China profitiert direkt vom Ölboom, kooperiert offshore mit Exxon. Doch die Hälfte der 800.000 Einwohner Guyanas lebt weiter in Armut. „Ich würde persönlich sagen, ich habe bisher nicht vom Öl profitiert. Das Geld zirkuliert nur oben, nie bei uns unten an der Basis“, sagt Marktfrau Roshana Dixon.
Ein weithin sichtbares Symbol für den Wandel, der Guyana erfasst hat: die Brücke über den Demerara-Fluss.
Die Folgen der „holländischen Krankheit“
Vom Ölboom ist in Georgetown außer auf den Baustellen kaum etwas zu sehen. Viele ungepflasterte Straßen, versumpft, die einst prächtigen britischen Kolonialhäuschen modrig, Kühe grasen am Wegesrand, Menschen campieren zwischen Müllbergen.
Der Widerspruch zwischen fossilem Reichtum und sozialer Notlage ist für Wirtschaftsexperte Ram ein Symptom der sogenannten Dutch Disease, der holländischen Krankheit. „Dutch Disease bedeutet einfach, dass die Ressourcen dorthin fließen, wo das Geld ist.“
Und das bedeutet im Fall Guyanas: zum Ölsektor. Das Personal fehlt dann in der traditionellen Landwirtschaft. Produkte verteuern sich. Gleichzeitig fließen durch die Exporte viele US-Dollar ins Land, die die eigene Währung, den Guyana Dollar, aufwerten. Die Preise steigen.
„Für mich gibt es keinen guten Ölstaat, egal wo du hinschaust. Es sind schlimmste Formen der Ausbeutung, Umweltzerstörung, Korruption“, kritisiert Aktivistin Nageer.
Guyana könnte ein neues Norwegen werden, wenn es in den Sozialstaat investiert. Oder ein zweites Venezuela, wo der Reichtum zur Instabilität geführt hat. Oder ein weiteres Nigeria, das unter extremer Umweltzerstörung leidet.
In vielen Teilen der Hauptstadt Georgetown ist vom Ölboom noch nichts angekommen – hier leben die verarmten Teile der Bevölkerung wie vor der Entdeckung der Ölvorkommen.
Bedrohter Wald
Unterwegs im Hinterland – ein Begriff aus der niederländischen Kolonialzeit, den die Menschen in Guyana bis heute verwenden. Das Hinterland ist alles, was hinter der Küste liegt. Savanne, Berge, Regenwald. Nur zehn Prozent der Bevölkerung leben hier. Sechs der neun indigenen Gruppen, die lokal als Amerindiens bezeichnet werden.
„Der Wald ist Leben. Wir hängen von ihm ab. Guayana kann heiß wie eine Sauna sein, aber dank des Waldes ist es angenehm“, sagt Octavius Hendrixs. Er ist indigener Ranger in einer Protected Area. Acht Prozent der Waldfläche Guyanas sind geschützt, denn der Wald ist bereits von dem Ölboom bedroht gewesen.
Auch eine neue Autobahn in Georgetown zeugt von den wachsenden Einnahmen des Landes.
Andere Rohstoffe locken
Unter dem dichten Blätterdach liegen Schätze wie Gold, Eisen und Uran verborgen. Neben chinesischen fördern auch kanadische Unternehmen und zahlreiche illegale Goldschürfer Gold. Das eingesetzte Quecksilber und andere Chemikalien schaden Umwelt und Menschen.
Hier im Schutzgebiet der Kanuku Mountains ist der Goldabbau verboten. Hendrixs springt aus einem Boot, klettert einen steilen Flusshang nach oben.
„Wir beobachten die Otterpopulation. Sie leben vom Fisch. Die Bestände würden durch den Goldabbau zurückgehen und damit die Otter verschwinden. Sie sind für uns also der wichtigste Indikator.“
Der Otter als eine Art Polizist der Biodiversität – es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. In anderen Ländern Lateinamerikas, Brasilien, Peru, Kolumbien sind dem Gold bereits riesige Waldflächen geopfert worden. Die Amerindians wollen im Einklang mit der Natur bleiben, trotz Gold und Ölvorkommen.
Ranger Hendrixs sieht den Ölreichtum kritisch. „Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich hoffe nur, dass das Öl so gewonnen wird, dass es keine großen Auswirkungen auf die Umwelt hat.“
Über hunderte Kilometer führt eine Schotterstraße von Georgetown durch den Urwald in den Süden Guyanas. Die Rohstoffe locken Unternehmen und Glücksritter an – und wecken Begehrlichkeiten beim Nachbarn Venezuela.
Hoffnungen und Ängste
Ob das machbar ist, muss sich beweisen. Guyana ist gespalten. Kritiker fürchten, dass die Regierung schlechte Verträge mit Exxon ausgehandelt habe, diese im Falle einer Ölkatastrophe nicht vollständig dafür aufkommen würden. Sie sorgen sich vor der Ölverseuchung, dem Abstieg, der Korruption.
Andere hegen vor allem die Hoffnung auf sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt. Guyana steht am Anfang einer Entwicklung, die über Generationen wirken wird.
Diese und weitere Reportagen sehen Sie im Weltspiegel – am Sonntag um 18.30 Uhr im Ersten.