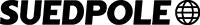Für die Commerzbank wird es eng. Wer geglaubt hatte, dass der Unicredit-Vorstandsvorsitzende Andrea Orcel das Interesse an der gelben Bank über den Sommer verlieren würde, sieht sich gründlich getäuscht. Unicedit hat abermals aufgestockt und hält nun 26 Prozent an der Frankfurter Bank. So steuern die Italiener geradewegs und unbeirrt auf die 30-Prozent-Schwelle zu, die eine Pflicht zum Übernahmeangebot auslösen würde.
Damit wäre dann die Zeit der Beteuerungen und Spekulationen über die Pläne Orcels vorbei. Dann läge der Ort der Entscheidungen genau dort, wo er im Falle einer börsennotierten Gesellschaft hingehört: Bei den Aktionären. Sie sind die Eigentümer und haben eine Wahl. Glauben sie an die Eigenständigkeit der Commerzbank oder wäre die auf den Mittelstand spezialisierte Bank unter dem Dach der sehr viel größeren Unicredit zukunftsfähiger?
Die Commerzbank-Übernahme wurde zum Politikum
Sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) haben sich im Abwehrkampf der Commerzbank positioniert. Sie bewerten das Verhalten Orcels als unfreundlich und sähen die Commerzbank in Zukunft lieber allein.
Warum das so ist, bleibt offen. Die Einmischung von Regierungen in marktwirtschaftliche Prozesse ist mehr als fragwürdig. Sie mag ihre Berechtigung in Zeiten haben, in denen ein systemrelevantes Unternehmen in Schieflage gerät.
Der Staat muss die Commerzbank nicht mehr stützen
Doch dieser Fall liegt bei der Commerzbank nicht vor – im Gegenteil. Kurz vor dem Kollaps in der Finanzkrise vom Staat gestützt, gilt die Commerzbank jetzt schon einige Jahre als erfolgreich restrukturiert und saniert. Dass der Staat aus dieser Zeit noch immer 12 Prozent hält, war nur noch damit zu begründen, dass sich der Aktienkurs so mies entwickelt hatte und Berlin nur mit Verlusten aus dem Engagement herauskäme. Das Argument ist längst obsolet.
Unter dem vorherigen, liberalen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich endlich die Erkenntnis durchgesetzt, nach über 15 Jahren die Staatsbeteiligung auflösen zu müssen. Dieser Prozess wurde vor fast einem Jahr gestartet.
Dass die Unicredit das erste Paket von vier Prozent erwerben konnte, sehen heute manche als eine Unachtsamkeit der die Transaktion ausführenden Bundesfinanzagentur. Tatsächlich ist aber auch das ein marktwirtschaftlicher Prozess. Es wirkt absurd, dass es ein Fehler sein soll, wenn eine europäische Bank in einem bewusst offen gehaltenen Verfahren eine andere europäische Bank erwerben will.
Angesichts der angespannten geopolitischen Lage und der auch unternehmerisch zweifelhaften Entwicklungen in den USA wird oft der Begriff von europäischer Wehrhaftigkeit bemüht. Das gilt für Computerchips, für Cloudlösungen, für Medikamente, für vielerlei. Diese Wehrhaftigkeit aber ist auch für die Finanzwirtschaft und ihre Kunden existenziell.
Europa braucht starke Banken, die sich auch nur ansatzweise mit amerikanischen Wall-Street-Banken lassen müssen können. Nicht, weil die Marktkapitalisierung an der Börse ein Wert an sich wäre. Sondern weil Kunden Banken brauchen, die komplexe Finanzierungen stemmen können, um ihre Geschäfte in dieser aufgewühlten Welt erfolgreich tätigen können.
Der Traum der Commerzbank, eigenständig zu bleiben, darf nur davon abhängen, ob sie im Fall eines Übernahmeangebots auch ihre Eigentümer von diesem Traum überzeugen kann. Auch Unicredit ist ihren eigenen Aktionären verpflichtet. Eine Übernahme muss auch für sie einen Sinn ergeben. Am Ende siegt allein die wirtschaftliche Logik. Hoffentlich.