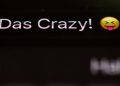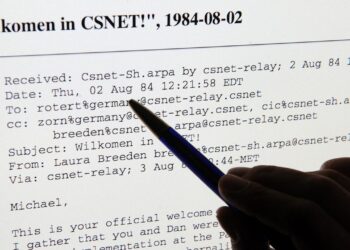faq
Koalitionspläne zur Alterssicherung Wer will was im Rentenstreit?
Stand: 21.11.2025 08:41 Uhr
Die Debatte um das Rentenniveau nach 2031 lähmt derzeit die Regierung. Weshalb weder Junge Union noch SPD derzeit ihre Positionen verlassen – und wie ein möglicher Ausweg aussehen könnte.

Was genau ist das Problem?
Die Junge Union (JU) verweigert weiterhin dem Gesetzentwurf zum Rentenpaket der Bundesregierung die Zustimmung. Sie fordert weniger Steuerausgaben zur Anpassung der gesetzlichen Rentenzahlungen für die Zeit nach dem Jahr 2031, als es der Gesetzentwurf vorsieht. Die JU ist die Jugendorganisation von CDU und CSU und verfügt über 18 Stimmen mit der „Jungen Gruppe“ in der Unionsfraktion – damit kann sie eine Mehrheitsabstimmung der Koalitionsparteien gefährden, da diese nur 12 Stimmen über der erforderlichen Kanzlermehrheit hat.
Mit der Forderung setzen die jungen Christdemokraten derzeit vor allem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unter Druck. Merz steht zu der Gesetzesvorlage, die im Haus der Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erarbeitet wurde. Sie ist bereits innerhalb der Regierung im Kabinett im August abgesegnet worden und wurde im Oktober im Bundestag in erster Lesung beraten.
Die Zeit drängt, da darin zusätzlich vorgesehene Maßnahmen wie die Ausweitung der Mütterrente auf alle Jahrgänge zum 1. Januar in Kraft treten sollen. Zugleich läuft die noch unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 2018 mit der SPD verabschiedete sogenannte Haltelinie des Rentenniveaus bei 48 Prozent zum Jahresende 2025 aus und bedarf einer Neuregelung, will man ein schnelleres Absinken des Rentenniveaus verhindern.
In den Koalitionsverhandlungen hatte sich Schwarz-Rot auf die Verlängerung dieser Haltelinie für die Rentenanpassung verständigt, die damit das Rentenniveau auf 48 Prozent stabilisiert. Bis zum Jahr 2031 soll es nun dabei bleiben, dies akzeptiert auch die Junge Union. Sie fordert jedoch eine andere Berechnungsgrundlage für die Jahre danach, als es der Regierungsentwurf vorsieht. Dieser setzt bei 48 Prozent an und reduziert ab 2032 das Rentenniveau um den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor, auf den sich die Koalition für die Zeit nach 2031 ebenfalls verständigt hat.
Die JU will ab 2032 so rechnen, als hätte es die Stabilisierung bis 2031 nicht gegeben. Damit würde das Rentenniveau sowohl 2035 als auch 2040 um einen Prozentpunkt tiefer liegen als mit der vorliegenden Regelung. Für 2035 hieße das 45,7 statt 46,7 Prozent, für 2040 wären es 45 statt 46 Prozent.
Was regelt eigentlich das Rentenniveau?
Das Rentenniveau wird oft falsch verstanden – gar als Wert, der die eigene Rente berechnet, also etwa 48 Prozent des eigenen Durchschnittseinkommens. Das ist nicht zutreffend. Das Rentenniveau sagt wenig über die Berechnung der individuellen Rentenhöhe für einzelne Rentnerinnen und Rentner aus, sondern ist ein Durchschnittswert. Dieser zeigt das Verhältnis zwischen einer fiktiven Durchschnittsrente nach 45 Beitragsjahren zum durchschnittlichen Einkommen von Arbeitnehmenden an. Er dient als Berechnungsgrundlage und faktische Untergrenze, deswegen wird um ihn politisch so gerungen. Steigen die Löhne stärker, steigen entsprechend auch Rentenanpassungen stärker.
Ein Absinken des Rentenniveaus heißt jedoch laut Rentenversicherung nicht, dass die Renten sinken. Das ist durch die Rentengarantie sogar gesetzlich ausgeschlossen. Wenn das Rentenniveau sinkt, können die Renten weiter steigen, aber eben nicht so stark wie die Einkommen.
Die Politik muss jedoch die Bevölkerungsentwicklung im Blick haben – bald sind besonders geburtenstarke Jahrgänge in Rente, die von geburtenschwächeren Jahrgängen finanziert werden müssen. Steigt die Zahl der Rentenbeziehenden schneller als die Zahl der Beitragszahlenden, dämpft zudem der von der Politik eingesetzte Nachhaltigkeitsfaktor den Anstieg der Renten. Die Finanzierungslücke in der gesetzlichen Rente wird bereits mit Bundeszuschüssen gestopft. Für den nächsten Bundeshaushalt 2026 hat das ifo-Institut berechnet, dass ein Drittel aller veranschlagten Steuereinnahmen in die Rentenversicherung fließen, also 127,8 Milliarden Euro.
Wie dramatisch ist die Lage für die Regierungskoalition?
Schwarz-Rot steckt dadurch mindestens am Rand einer großen Krise – oder schon drin. Tatsächlich ist bereits bei Regierungsmitgliedern die Rede davon, dass die Koalition dadurch gefährdet ist: In der Koalition sei es schon „unruhig“, sagte Bas am Dienstag beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Wenn die Verabschiedung des Rentenpakets nicht gelänge, werde es „noch unruhiger“. Wer gerade die Koalition gefährde, sitze in der Union, so Ministerin Bas.
Kanzler Merz wiederum wurde beim selben Forum bereits mit Spekulationen über ein Scheitern der Regierung und einer möglichen Minderheitsregierung konfrontiert. Er gab sich weiterhin zuversichtlich, eine Lösung zu finden und schloss eine Minderheitsregierung aus. Man werde auch im kommenden Jahr noch mit der SPD regieren.
Dennoch hat Merz zum wiederholten Male Probleme mit Abweichlern in den eigenen Reihen, die damit enorme Macht entfalten. Im Regierungsviertel wird bereits diskutiert, ob er das Instrument einer Vertrauensfrage nutzen muss, um die eigenen Reihen zu disziplinieren. Auch Kanzler Gerhard Schröder (SPD) verband 2001 eine Abstimmung über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr mit der Vertrauensfrage, um die Reihen zu schließen.
Was sagt dazu der Koalitionsvertrag?
Der Koalitionsvertrag ist eindeutig beim Sichern des Rentenniveaus bis 2031 mit den besagten 48 Prozent – und auch dabei, wie die Mehrausgaben finanziert werden sollen, nämlich mit Steuermitteln. Zudem bekennt sich die Koalition zum Nachhaltigkeitsfaktor, der Renten entsprechend der demografischen Entwicklung dämpft.
Eine Unschärfe muss man dem Koalitionsvertrag jedoch darin attestieren, was als Berechnungsgrundlage ab Januar 2032 gelten soll. Genau in diese Lücke stößt die Junge Union nun mit ihrem Rechenmodell. Allerdings ist das vom Regierungsentwurf angewandte Rechenmodell – also von den bis 2031 gehaltenen 48 Prozent aus zu rechnen – naheliegend. So verfährt auch die unter Merkel verabschiedete Rentenstabilisierung bis 2025, die ebenfalls keinen solchen Rückholeffekt vorsah.
Auch der Ökonom Martin Werding nannte es im ZDF „naheliegend“, vom Sicherungsniveau aus weiterzufahren, was sich bis dahin ergeben hat. Aber es hätte auch Alternativen gegeben, sagt das Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft („Wirtschaftsweise“). In der Tat legt das der Koalitionsvertrag nicht zwingend fest. Andererseits ist davon auszugehen, dass es eigens erwähnt worden wäre – wenn man nicht die naheliegende Lösung gewollt hätte.
Aus Regierungskreisen heißt es zudem, dass es bei den Verhandlungen klar gewesen sei, dass man rechnerisch bei den 48 Prozent ansetzt. Auch Merz bekannte sich im Bericht aus Berlin jüngst erneut zu dieser Mechanik: „Wenn man im Auto irgendwo anhält und später weiterfährt, dann fährt man an der Stelle weiter, wo man angehalten hat – und nicht an der Stelle, wo man wäre, wenn man nicht angehalten hätte.“
Wieso sorgt das für so viel Unruhe in Teilen der Union?
Unruhe gibt es vor allem bei der Jungen Union, die zwar seit September die Änderung am Gesetzesentwurf fordert, jedoch schon seit dem Koalitionsvertrag insgesamt eine andere Rentenpolitik anmahnt. Für sie ist es eine Frage der Generationengerechtigkeit. Man dürfe keine Vorfestlegungen bis in die 30er-Jahre treffen, sagte der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Pascal Reddig dem Stern.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer stellte sich an die Seite der Kritiker. Kretschmer, der auch stellvertretender CDU-Vorsitzender ist, äußerte sich im Vorfeld des Auftritts von Bundeskanzler Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union am vergangenen Wochenende. Die Kritik junger Unionspolitiker sei berechtigt – sagte er gegenüber der Funke Mediengruppe. Die derzeitige Rentenpolitik vergrößere das Problem.
Umgekehrt gibt es innerhalb der Unionsfraktion nach Informationen von tagesschau.de genauso Unbehagen am Vorgehen der JU, mit einer Detailfrage die Regierung in eine solche Kommunikationskrise zu stürzen. Die sei destruktiv und mache eine Fachfrage zu einer Machtfrage. Man müsse sich jetzt auch auf der anderen Seite bewegen und abrüsten.
Warum bleibt die SPD bei ihrer Haltung?
Die SPD verweist auf Absprachen bei den Koalitionsverhandlungen und auch auf die Präambel im Koalitionsvertrag. Dort heißt es: „Die Rente bleibt über die Legislatur hinaus stabil“. Der Gesetzentwurf gehe nicht über den Koalitionsvertrag hinaus, heißt es im Arbeitsministerium. Für die SPD ist die Sicherung stabiler Renten eine wichtige Identitätsfrage – und eines ihrer Hauptwahlkampfversprechen. Zudem hat sie das Gefühl, sich bei der Frage schon stark bewegt zu haben. Noch im Oktober 2024 wollte die SPD-geführte Ampelregierung das Halteniveau in Höhe von 48 Prozent bis mindestens 2039 festschreiben.
Aus der SPD-Bundestagsfraktion kam scharfe Kritik an den Änderungsforderungen seitens Teilen der CDU. „Die SPD hat stabile Renten durchgesetzt und an anderen Stellen dafür Kompromisse gemacht“, sagte SPD-Vizefraktionschefin Dagmar Schmidt der Nachrichtenagentur AFP. Das Rentenpaket sei ein „zentrales Versprechen für Stabilität und Verlässlichkeit“.
Die Forderungen aus der CDU liefen auf Rentenkürzungen hinaus – „und dafür gibt es keinerlei Grundlage im Koalitionsvertrag“, sagte Schmidt weiter. Die SPD-Politikerin forderte den Unionsfraktionschef auf, seine Fraktion auf Koalitionslinie zu bringen: „Ich erwarte von Jens Spahn, dass er seine Reihen endlich ordnet.“ Innerhalb der SPD-Fraktion gibt es die Erwartung, dass mehr Abstimmungsdisziplin gezeigt wird – immerhin habe die SPD ebenfalls bereits für Projekte gestimmt, bei denen sie sich schwertat, etwa die Einschränkung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen. Anders könne man jedoch nicht gemeinsam regieren, heißt es in Fraktionskreisen.
Dass mit dem Rechenmodell der Jungen Union tatsächlich ab 2039 eine Rentenkürzung entstünde, wie zuweilen von SPD-Abgeordneten behauptet wird, lässt sich nach Informationen von tagesschau.de jedoch nicht belegen: Würde das Rentenniveau im Jahr 2032 „schlagartig“ von 48 auf 47 Prozent abgesenkt, ergäbe sich nach aktueller Vorausberechnung immer noch eine kleine positive Rentenanpassung (etwa 0,25 Prozent). Eine Negativanpassung, die durch die sogenannte Rentengarantie verhindert werden würde, ergibt sich also selbst bei dieser Variante nicht.
Wie könnte ein Ausweg aussehen?
Es ist schwer vorstellbar, dass sich die SPD bei einer für sie so entscheidenden Identitätsfrage bewegt, weil einige Unionsabgeordnete ihren bereits mit dem Bundeskanzler und dem Bundeskabinett abgestimmten Gesetzentwurf aufbrechen wollen. Merz und Spahn haben das verstanden und versuchen, das derzeit ganz offen in internen Gesprächen mit ihren jungen Rebellen zu klären. Dem Kanzler ist im Grundsatz klar, dass der kleinere Koalitionspartner seine Erfolge bei Kernthemen braucht.
Genauso schwer vorstellbar ist, dass der Kanzler die Vertrauensfrage wegen der Detailfrage eines Rentenniveaus nach 2031 stellt, welches auch noch laut Regierungsentwurf auf reinen Zahlenprognosen mit Vorbehaltsklauseln steht.
Ein Ausweg könnte darin liegen, die „Junge Gruppe“ der Unionsfraktion inhaltlich bei der Rentenfrage aufzuwerten und klarzumachen, dass sie an den entscheidenden noch ausstehenden Rentenreformen zentral beteiligt und im Vorfeld politischer Entscheidungen gehört wird. Dazu will die Regierung eine Kommission einsetzen, die Vorschläge erarbeitet.
Grundsätzlich habe die Junge Union ja Recht, sagt Rentenexperte Ralf Kreikebohm im Gespräch mit tagesschau.de: „Wenn wir jetzt über das Rentenniveau entscheiden, haben wir über eine große finanzielle Stellschraube schon entschieden – es braucht aber mehrere Maßnahmen, um das Rentensystem weiter zu stabilisieren.“ Und die stünden noch aus.
Eine sichere Mehrheit für die Regierungskoalition muss in jedem Fall stehen, bevor es in die Abstimmung zum aktuellen Gesetzesentwurf geht. Eine fehlende Mehrheit beim Rentenpaket kann sich Schwarz-Rot schlicht nicht leisten, will man noch glaubwürdig seine Regierungsfähigkeit vertreten – zudem bestünde noch die Gefahr, dass das Vorhaben mit Stimmen der AfD durchgehen könnte – beides ein erhebliches Risiko für die Koalition.
Merz hatte vorgeschlagen, den Bedenken der Nachwuchspolitiker in einem „Begleittext“ oder Entschließungsantrag zum aktuellen Gesetzentwurf Rechnung zu tragen. Doch dazu hieß es von der „Jungen Gruppe“ bisher: „Ein Entschließungsantrag ist viel zu unverbindlich“.
Besser wäre, wenn die angekündigte Rentenkommission schnell Vorschläge vorlege, die am besten vor der Sommerpause 2026 beschlossen würden – „mit einem grundlegenden Rezept, wie wir die Rente in Zukunft aufstellen wollen“. Hinter diesem Ziel wiederum könnten sich alle, Unionsfraktion wie SPD-Abgeordnete, versammeln – das steht so schließlich bereits im Koalitionsvertrag schwarz auf weiß.