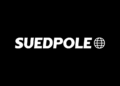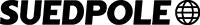Nach dem Erdbeben in Afghanistan Mehr als 2.200 Tote – und die Hoffnung schwindet
Stand: 04.09.2025 16:46 Uhr
Nach dem Erdbeben in Afghanistan sind bereits mehr als 2.200 Tote geborgen worden. Die Lage im Katastrophengebiet wird dadurch erschwert, dass die Taliban ausländische Hilfsorganisationen abgeschreckt haben.
Aus der Luft wird das ganze Ausmaß sichtbar: Statt Häusern sind nur Trümmer und Schutt zu sehen. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Ein Video der Taliban zeigt, wie Helfer Lebensmittelpakete aus geringer Höhe abwerfen – ohne die alten Militärhubschrauber aus russischer Produktion geht momentan kaum etwas. Diese Abwürfe sind aktuell die einzige Möglichkeit, Menschen in den entlegenen Bergdörfern zu erreichen, landen können die Hubschrauber dort nicht.
Im Regionalkrankenhaus von Nangarhar liegen die Menschen, die Glück hatten. Sie wurden lebend aus den Trümmern gerettet – so wie Ghulam Rahman. Sein Gesicht ist geschwollen, ein Auge ist stark verletzt. Der 37-Jährige stammt aus der am schlimmsten betroffenen Provinz Kunar. Dort lebte er mit seiner Familie hoch oben in den Bergen, erzählte er dem ARD-Studio Südasien. Das Beben überraschte ihn im Schlaf, und als er aufwachte, war sein zweistöckiges Haus eingestürzt.
Krankenhäuser kritisieren fehlende Ausstattung
Sein ältester Sohn habe nach ihm gerufen, erinnert er sich. „Er versuchte, den schweren Stein von meiner Schulter zu heben, aber er schaffte es nicht. Später, als ich mich befreien konnte, sah ich meine Frau und meine anderen Kinder – sie waren alle tot.“ Insgesamt habe er 61 Verwandte durch das Beben verloren.
Die Ausstattung des Krankenhauses in Nangarhar wirkt karg: die Metallbetten sind einfach, die Wände weiß gekachelt. Krankenpfleger Saidullah kümmert sich um einen älteren Patienten, er wirkt erschöpft. Seine dunklen Haare kleben ihm nass und wirr auf der Stirn. Er erzählt: „Zwei Tage lang haben wir nichts gegessen – wir wollten nur die Patienten versorgen.“
Es gebe genügend Personal und auch viele Betten, sagt er, aber es fehle an Gerätschaften und technischer Ausstattung. „Zum Beispiel haben wir kein EKG für die Untersuchungen, auch Monitore zur Kontrolle des Herzschlags sind nicht vorhanden. Wir brauchen die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, damit die Krankenhäuser hier nach internationalen Standards arbeiten können.“
Wenig internationale Hilfe seit Machtübernahme der Taliban
Die radikal-islamischen Taliban selbst haben bereits um internationale Unterstützung gebeten. Seit der Machtübernahme vor vier Jahren ist das Netz internationaler Hilfe stark ausgedünnt. Viele Länder haben ihre Unterstützung drastisch zurückgefahren.
Die Verzweiflung im Krankenhaus ist greifbar: Jetzt geht es zunächst darum, Verletzten so schnell wie möglich zu helfen – doch was kommt danach? Ein Mann macht sich große Sorgen: „Wir bitten die Regierung, uns Land zu geben. Wir haben alles verloren, auch unsere Häuser. Zurück in die Berge gehen wir nicht mehr.“
Fast 7.000 Häuser wurden nach offiziellen Angaben zerstört. Auch vier Tage nach der Katastrophe ziehen Einsatzkräfte und freiwillige Helfer noch immer weitere Opfer aus den Trümmern. Auffällig ist, dass auf Bildern aus dem Katastrophengebiet vor allem Männer zu sehen sind.
Mehr Hilfsangebote für Frauen nötig
Christina Ihle vom afghanischen Frauenverein in Hamburg erklärt die Gründe. Die Organisation ist vor Ort im Erdbebengebiet aktiv. „Einerseits sind bisher tatsächlich mehr Männer gerettet worden oder konnten sich von alleine aus den Trümmerbergen befreien als Frauen und Kinder, einfach weil sie stärker sind“, sagt Ihle. Darüber hinaus verweist sie auf das Sittengesetz, das seit Sommer 2024 in Kraft ist. „Es verbietet, dass Frauen abgebildet und gefilmt werden.“
Die Region ist sehr konservativ und patriarchalisch geprägt. Familien hätten Angst, verletzte Frauen allein in einen Helikopter zu setzen, in dem fremde Männer sitzen. Hilfe komme trotzdem bei den Frauen an, betont Ihle – nur deutlich schwieriger. Außerdem brauche es Ansprechpartnerinnen unter den Helfenden.
Eigentlich dürfen Afghaninnen nicht für ausländische Organisationen tätig sein. In Katastropheneinsätzen wie diesem lasse sich jedoch verhandeln, sagt Ihle. Frauen hätten andere Bedürfnisse als Männer, etwa bei medizinischer Versorgung oder Schutz vor Übergriffen.
„Umso wichtiger ist es, dass jetzt auch weibliche Helfende in das Katastrophengebiet kommen.“ Das sei in den kommenden Tagen der Fall, sagt Ihle. „Erste weibliche medizinische Teams sind schon dort und auch wir werden jetzt hoffentlich schnellstmöglich unser Nothilfeteam um Kolleginnen aufstocken können.“