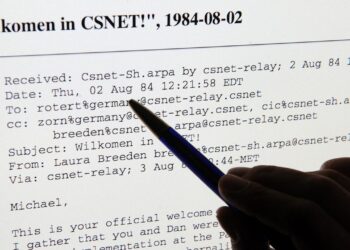analyse
Stand: 23.10.2025 18:26 Uhr
Die Steuereinnahmen steigen in den kommenden Jahren etwas stärker als bisher erwartet. Davon hat der Bund praktisch nichts. Für Finanzminister Klingbeil muss das politisch aber kein Nachteil sein.

Auf den ersten Blick sieht es gut aus für Bund, Länder und Gemeinden: Bis zum Jahr 2029 können sie mit Mehreinnahmen in Höhe von 33,6 Milliarden rechnen. Verglichen wird dabei mit der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai. Doch der Blick zurück offenbart das erste Problem: Im Mai hatten die Steuerschätzer ihre Prognose um fast die gleiche Summe (nämlich um 33,3 Milliarden) nach unten korrigiert. Viel Lärm um nichts?
Der zweite Blick offenbart aber gravierende Unterschiede zwischen den staatlichen Ebenen: Während Länder und Kommunen bis 2029 tatsächlich mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen können, sieht es beim Bund ganz anders aus. Hier hat sich unterm Strich gegenüber der Steuerschätzung vom Mai fast nichts geändert. Pech für Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), der zusätzliche Einnahmen gut gebrauchen könnte.
Entlastung für Länder und Kommunen
Hintergrund für die unterschiedliche Entwicklung sind zwei gegenläufige Effekte. Da ist zum einen das Wirtschaftswachstum, das nach Einschätzung von Konjunkturforschern und der Bundesregierung im kommenden Jahr höher liegen dürfte als noch im Mai vermutet. Das sorgt für höhere Einnahmen auf allen staatlichen Ebenen – vom Bund bis zu den Kommunen.
Dem entgegen stehen die Folgen von Steuerrechtsänderungen. So gehen dem Fiskus durch den sogenannten Investitionsbooster Steuereinnahmen verloren – was freilich politisch gewollt ist. Denn die steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen sollen als Anreiz dafür dienen, dass die Unternehmen mehr investieren. Die entsprechenden Steuerausfälle würden eigentlich auch Länder sowie Städte und Gemeinden treffen, doch der Bund hat zugesagt, diese Steuerausfälle zum Teil zu übernehmen.
Die neue Steuerschätzung bringt also etwas Entlastung für die Finanzminister der Länder und die Kämmerer in den Kommunen. Bundesfinanzminister Klingbeil hingegen muss sich weiter darüber Gedanken machen, wie er die bislang mit insgesamt rund 170 Milliarden Euro bezifferten Löcher in den Haushalten zwischen 2027 und 2029 stopfen kann.
Gute Argumente für den Minister
Allerdings hilft ihm die neue Prognose in gewisser Weise politisch. Gegenüber den eigenen Kabinettskollegen in Berlin kann er deutlich machen, dass für Extrawünsche kein Geld da ist.
Und gegenüber den Ländern hat er ein gutes Argument an der Hand, wenn diese sich erneut einen Ausgleich von Steuerausfällen durch den Bund wünschen. Eine Kompensation im Zusammenhang mit der ab Januar 2026 geplanten Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie sowie die höhere Pendlerpauschale hat Klingbeil auch schon kategorisch ausgeschlossen.
Finanziell bleibt es aber eine große Herausforderung, den Bundeshaushalt in Ordnung zu bringen. Die Milliardenschulden, die sich die schwarz-rote Bundesregierung gönnt, reichen nämlich nicht aus, um alle Begehrlichkeiten zu befriedigen. Zumal der Haushalt aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der Finanzprobleme in den Sozialversicherungen wenig Spielraum für Veränderungen bietet – ein Problem, das der Bundesrechnungshof seit Jahren beklagt. Dazu kommt, dass die Milliardenschulden selbst zum Problem für den Bundeshaushalt werden – durch die steigende Zinslast.
Eine Chance für Klingbeil?
Finanzminister Klingbeil hat daher schon angekündigt, sich um die Jahreswende mit den anderen Parteivorsitzenden von Schwarz-Rot zusammenzusetzen, um ein Sparpaket für die Jahre ab 2027 zu erarbeiten: „Am Ende sind wir in der Pflicht, ein gemeinsames Paket vorzulegen, eine Lücke zu schließen und damit dieses Land auf Vordermann zu bringen.“
Keine leichte Aufgabe für den SPD-Co-Vorsitzenden auch angesichts der divergierenden Interessen innerhalb der Koalition. Zugleich aber auch eine Chance, sich als Reformer zu profilieren.