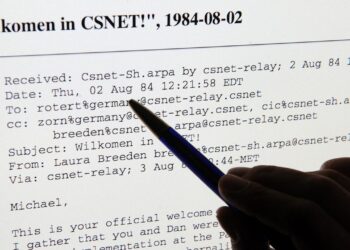analyse
Einigung nach langer Debatte Wie der Wehrdienst-Kompromiss zustande kam
Stand: 13.11.2025 18:40 Uhr
Die Koalition hat unter anderem eine flächendeckende Musterung für den Wehrdienst vereinbart. Der Weg zur Neuregelung war mehr als holprig. Doch für Verteidigungsminister Pistorius ist die Sache noch nicht erledigt

Berlin, Reichstagsgebäude. Es ist noch nicht einmal acht Uhr, als Verteidigungsminister Boris Pistorius am Morgen gut gelaunt zur SPD-Fraktion geht. Am späten Abend wurde der Wehrdienst-Kompromiss gefunden. Nun wirkt der SPD-Politiker entspannt.
Auf die Frage, ob er mit dem Gesetzentwurf jetzt zufrieden sei, sagt er knapp: „Ja, bin ich.“ Ob er es wirklich ist – schwer zu sagen. Fernab der Hauptstadt, in Leipzig: „Nichts Halbes und nichts Ganzes.“ So kommt einem jungen Mann dort das neue Wehrdienstgesetz vor. Eine spontane Reaktion auf eine Straßenumfrage. Für viele dürfte er damit den Finger in die Wunde gelegt haben. Wie viel Pflicht, wie viel Freiwilligkeit soll es denn nun sein?
Die Politik hat wochenlang um eine Lösung gerungen, war zwischendurch so zerstritten, dass die Arbeitsgruppe der beiden Koalitionsfraktionen eine Pressekonferenz platzen lassen musste, als bereits alle Journalisten im Raum saßen. Ein Debakel, aber beim neuen Wehrdienst lief es von Anfang an nicht rund.
Mehr „nachsteuern“ als gedacht
Am 27. August hatten der Kanzler und sein Verteidigungsminister einen großen Auftritt. Das Kabinett hatte zum ersten Mal seit Langem im Verteidigungsministerium getagt. Friedrich Merz wollte demonstrieren, wie wichtig Sicherheitspolitik für die neue Regierung ist.
An dem Tag verkündete der Kanzler an der Seite von Boris Pistorius, dass das Kabinett sich auch auf „das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes geeinigt“ hätte. Der CDU-Politiker schränkte ein, wenn man nachsteuern müsse, dann werde man das tun. Aber wird kaum gemeint haben, nachzusteuern, bevor das Gesetz überhaupt verabschiedet ist.
Große Verärgerung auf allen Seiten
Die schönen Bilder aus dem Verteidigungsministerium, die schwarz-rote Einigkeit demonstrieren sollten, hatten nicht lange Bestand. In der Union grummelte es. Der Gesetzentwurf sollte nachgebessert werden.
Eine Arbeitsgruppe aus Union und SPD erarbeitete einen Kompromiss, doch als der zuständige Minister realisierte, was der beinhaltete – nämlich eine Art Losverfahren, das darüber entscheiden sollte, wer gemustert wird und wer nicht, und die Forderung nach konkreten Zielzahlen für die Personalgewinnung – stellte Pistorius sich quer. Er wollte kein Los- oder Zufallsverfahren, wie es genannt wurde; er wollte die verpflichtende Musterung eines ganzen Jahrgangs. Und er wollte nicht an seinen Rekrutierungszahlen gemessen werden.
Die bereits erwähnte geplante Pressekonferenz wurde kurzerhand abgesagt. Die Verärgerung war auf allen Seiten groß, und die Verunsicherung in der Bevölkerung noch größer.
Freiwilligkeit bleibt
Als ein neuer Kompromiss gefunden ist, versucht Pistorius das Gezerre der vergangenen Wochen in einer so existentiellen Frage wie dem Wehrdienst zu erklären: „Wir sind als neues Team, gewissermaßen ohne uns aufzuwärmen, auf den Platz gegangen, das führt dann schon mal zu der einen oder anderen Zerrung. Das haben wir überwunden und sind dann sehr geschmeidig, würd‘ ich mal sagen.“
Der Verteidigungsminister geht weitgehend gestärkt aus der schwierigen Kompromissfindung hervor. Der Wehrdienst bleibt zunächst freiwillig; es gibt keinen Automatismus im Gesetzentwurf zur Pflicht. Das war Pistorius wichtig, aber ganz losgeworden ist er das Wort „Zufallsverfahren“ nicht.
Außerdem muss sein Ministerium künftig alle sechs Monate dem Parlament Zahlen vorlegen, wie viele Soldaten die Bundeswehr nun genau hat. Aber es gibt nur einen Zielkorridor und keine konkreten Zahlen.
Geht es nach dem Minister, würde er den Fokus, wie über den Wehrdienst geredet wird, ab jetzt gerne verschieben, weg von einem Verfahren, das kontrovers diskutiert wurde, hin zu der Frage „wie attraktiv, wie notwendig und wie sinnvoll der Dienst bei der Bundeswehr“ sei.
„Nichts Halbes und nichts Ganzes“
Jetzt muss sich zeigen, ob es Pistorius gelingt, die Truppenstärke allein mit freiwilligen Wehrdienstleistenden so zu erhöhen, wie die NATO es verlangt. Davon wird auch abhängen, wie erfolgreich er als Verteidigungsminister sein wird.
Das Dilemma: Vielleicht wäre es die eindeutigere Entscheidung, die Wehrpflicht wiedereinzusetzen, aber dann, das räumen manche ein, sollte zugleich das Grundgesetz geändert werden, um die Wehrpflicht für junge Männer und junge Frauen einzuführen. So wie es der Bundespräsident zum 70. Geburtstag der Bundeswehr gesagt hat: „Nach meiner Überzeugung wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die die einen bei der Bundeswehr und die anderen im sozialen Bereich leisten.“
Aber dem stehen die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag entgegen. Denn für eine Grundgesetzänderung braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und so ist die Einigung vielleicht doch nicht mehr als „nichts Halbes und nichts Ganzes“, wie der junge Mann in Leipzig sagte.