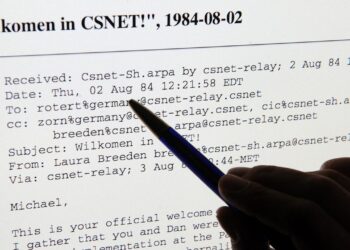Stand: 09.11.2025 12:37 Uhr
Der 9. November ist für Deutschland in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag. Auch dieses Jahr fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Bundespräsident Steinmeier warnte vor den Gefahren für die Demokratie.
Anlässlich des heutigen Jahrestags der Ausrufung der Republik 1918, der Pogromnacht 1938 und des Mauerfalls 1989 fanden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lud ins Schloss Bellevue, um an die historischen Ereignisse zu erinnern. Das Staatsoberhaupt hielt eine Rede, in der es laut Ankündigung um den Schutz der wehrhaften Demokratie gehen sollte.
Das Bundespräsidialamt hatte zum 9. November erklärt: „Er spiegelt sowohl die Aufbrüche zu Demokratie und Freiheit wie den Schrecken von Gewaltherrschaft und Antisemitismus wider. Das Wissen um beides, um Licht und Schatten, um Momente von Mut und Menschlichkeit ebenso wie um Abgründe von Diktatur und Zerstörung der Menschenwürde, birgt wichtige Lehren für die Gegenwart.“ Bei der Veranstaltung sollten die Schauspieler Jens Harzer und Marina Galic Texte aus den jeweiligen Epochen deutscher Geschichte lesen.
Namen von 55.696 ermordeten Juden werden vorgelesen
Vor dem Jüdischen Gemeindehaus in Berlin wurden am Vormittag die Namen von 55.696 Juden vorgelesen, die während des Holocaust in der Hauptstadt ermordet wurden. Das Internationale Auschwitz Komitee forderte Solidarität mit den Überlebenden der Shoa. Für diese sei der 9. November ein Tag des Gedenkens und ein Tag der Demokratie, erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner: „Deshalb hoffen sie darauf, dass die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit den Überlebenden und ihren Erinnerungen solidarisch ist und die Demokratie gegen die Attacken und Parolen rechtsextremer Populisten und Parteien stärkt und beschützt.“
Was geschah bei den Novemberpogromen 1938?
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 sowie in den folgenden Tagen kam es im damaligen Deutschen Reich zu brutalen Angriffen auf Juden und jüdische Einrichtungen. Synagogen, Betstuben, jüdische Friedhöfe, Geschäfte und Versammlungsräume wurden zerstört, zahlreiche Menschen ermordet, Zehntausende in Konzentrationslager verschleppt.
Den Vorwand für die Ereignisse bildete das Attentat des 17-jährigen Herschel Grünspan auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris am 7. November. Grünspan wollte mit seiner Tat gegen die Deportation von 17.000 Juden aus Deutschland an die polnische Grenze protestieren. Propagandaminister Joseph Goebbels nutzte den Anlass zu einer Hetzrede. Im ganzen Deutschen Reich organisierten SA- und NSDAP-Mitglieder daraufhin die Übergriffe gegen Juden.
Die Novemberpogrome markieren den Übergang von der Diskriminierung zur systematischen und gewaltsamen Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch das NS-Regime.
Die Auschwitz-Überlebende und Komitee-Präsidentin Eva Umlauf sagte: „An diesem Tag des Gedenkens rücken mir die Flammen, die in der Nacht des 9. November 1938 in Deutschland jüdische Geschäfte und jüdische Menschen bedrohten, ganz nah.“
Mit Blick auf den Mauerfall am 9. November 1989 betonte Umlauf, sie sei froh, heute in einem nicht mehr geteilten Europa und auch in einem wiedervereinigten, demokratischen Deutschland leben zu dürfen. Aber wenn in diesen Tagen immer spürbarer werde, dass sich Menschen erneut für Ideologien des Hasses und des Antisemitismus begeistern lassen, dann werde ihr „ganz kalt“.
Kulturstaatsminister Weimer: Fall der Mauer kein Geschenk des Schicksals
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer würdigte zum Mauerfall-Gedenken den Mut der Menschen in der damaligen DDR. „Der Fall der Mauer am 9. November 1989 war kein Geschenk des Schicksals. Er war die Ernte eines langen, mühsamen Kampfes mutiger, tapferer, hoffnungsvoller Menschen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“, erklärte Weimer. Die Friedliche Revolution von 1989 sei ein beispielloses Ereignis der Weltgeschichte – „eine Revolution ohne Gewalt, getragen von Gebeten, Kerzen und Zivilcourage.“
Anlässlich der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth betonte Weimer: „In Zeiten, in denen neue Mauern hochgezogen werden – nicht unbedingt aus Beton, vor allem aber in Köpfen und Herzen -, in denen Spaltung wieder zum politischen Programm erhoben wird, ist Mödlareuth ein Mahnmal.“ Der Freiheitsdrang des Menschen sei stärker als jede Mauer.
Das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth erinnert an die Geschichte der deutschen Teilung und ihre Folgen bis in die Gegenwart. Das Dorf Mödlareuth, das auch als „Little Berlin“ bezeichnet wird, lag genau auf der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Die etwa 50 Einwohner trennten scharf bewachte Grenzanlagen und ab 1966 eine 3,30 Meter hohe Betonsteinmauer.