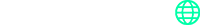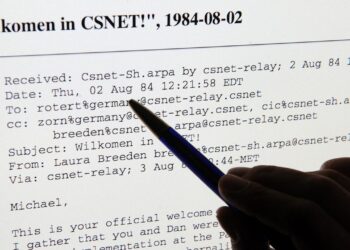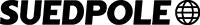Stand: 05.12.2025 15:07 Uhr
Neue Daten des Robert Koch-Instituts zeigen: Ein Großteil der Deutschen ist mit der Verantwortung für die eigene Gesundheit überfordert. Und in manchen Bereichen klafft die soziale Schere immer weiter auf.
Krankheitssymptome deuten und Gesundheitsinformationen aus Sozialen Medien einordnen können, Impfentscheidungen treffen und über die Bedeutung von Sport Bescheid wissen: Erstaunlich vielen Menschen in Deutschland fällt es schwer, für ihre eigene Gesundheit Sorge zu tragen. Das zeigen die Befragungsdaten aus dem ersten Jahr der Längsschnittstudie „Gesundheit in Deutschland“ des Robert Koch-Instituts (RKI).
Alle Bildungsschichten betroffen
Vier von fünf Erwachsene weisen demnach eine geringe „allgemeine Gesundheitskompetenz“ auf. „Auch Menschen mit mittlerem – und einige auch mit hohem – Bildungsniveau stehen vor diesem Problem“, sagt die RKI-Gesundheitswissenschaftlerin Susanne Jordan. „Dann haben wir ja auch noch gezielte Falschinformationen, und hinzu kommt auch, dass unser Gesundheitswesen sehr komplex ist.“
Selbst die Grundlagen für eine gesunde Ernährung sind offenbar nicht weit genug verbreitet. Über die Hälfte der Männer verfügt den Daten zufolge nicht über das Wissen und die Möglichkeiten, für eine gesunde Ernährung zu sorgen; bei den Frauen sind es noch etwas mehr als ein Drittel. „Und ich muss es mir auch leisten können“, ergänzt Judith Fuchs vom Fachgebiet „Körperliche Gesundheit“ beim RKI. „Ein großer Korb frisches Gemüse ist mittlerweile durchaus eine Investition, das muss man immer im Hinterkopf behalten.“
Soziale Ungleichheit verschärft sich
Die Erkenntnisse sind besonders gravierend, wenn man den zweiten großen Befund der Studienreihe in den Blick nimmt: Die gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland ist nach wie vor hoch und hat sich in manchen Bereichen zuletzt noch verstärkt. „Wir sehen, dass sich dieses Muster über ein sehr, sehr breites Spektrum von Gesundheit und Krankheit zeigt“, sagt Jens Hoebel, der sich beim RKI mit den sozialen Einflussfaktoren auf die Gesundheit befasst.
Damit liegt Deutschland nach seiner Einschätzung im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Wer wenig verdient, in einem insgesamt schlechteren Wohnumfeld lebt oder einen niedrigen Bildungsstatus hat, leidet deutlich häufiger unter schlechter Gesundheit als privilegiertere Menschen.
Das gilt sowohl für die psychische als auch die körperliche Gesundheit. So wurde in der niedrigen Bildungsgruppe doppelt so häufig Diabetes festgestellt als bei höher Gebildeten. Ein ähnliches Verhältnis gibt es bei Depressions- und Angstsymptomatiken. Auch chronische Krankheiten und andere körperliche Einschränkungen werden deutlich häufiger berichtet.
Bei der Vorsorge schneidet Deutschland nicht gut ab
Der gerade erst veröffentlichte Public Health Index der AOK zeigt, dass die Bundesrepublik in der politischen Gesundheitsvorsorge deutlich hinterherhinkt. Im Ländervergleich landet Deutschland in drei von vier Bereichen auf den hinteren Rängen: Das betrifft Tabak, Alkohol und Ernährung. Bei Bewegung belegt Deutschland Rang 10 von 18, zusammen mit Österreich. Insgesamt landet Deutschland damit auf Rang 17.
„Gleichzeitig ist zu beobachten, dass erste Länder die Gesundheitskompetenzförderung auf die politische Agenda gehoben haben“, sagt Susanne Jordan und verweist auf das Beispiel Österreich. „Die haben ja sogar vor einigen Jahren ein Gesundheitsziel ‚Gesundheitskompetenz‘ etabliert.“ In einer vergleichenden OECD-Studie von 2019 gelang es Österreich daraufhin, Deutschland in diesem Bereich zu überholen.
Bessere Informationen, höhere Zusatzsteuern
Was helfen könnte, ist aus Sicht der RKI-Forschenden relativ klar: Bessere Informations- und Bildungsangebote für den Gesundheitsbereich zum Beispiel, um Patienten mehr einbinden zu können: „Bin ich in der Lage zu verstehen, was mir gerade erklärt wurde, bin ich in der Lage nachzufragen? Traue ich mich nachzufragen, weiß ich genug, um nachfragen zu können? Da liegt einfach vieles im Argen“, erläutert RKI-Wissenschaftlerin Judith Fuchs.
Doch auch Maßnahmen, die eine gesunde Lebensweise leichter machen, wie eine Zuckersteuer oder eine Erhöhung der Tabaksteuer seien wirksam: „Das sind so Dinge, die halte ich zumindest nicht für ganz ausgereizt.“
Prävention fängt beim Wohnen an
Sozialepidemiologe Jens Hoebel verweist auf strukturelle Prävention: stadtplanerische Maßnahmen zum Beispiel, um Luftverschmutzung und Lärmbelastung zu verringern, aber auch Armutsbekämpfung. Verkehrsberuhigte „Superblocks“ wie in Barcelona gelten als Vorzeigeprojekt. Tatsächlich habe das Wohnumfeld eine besondere Bedeutung: „Auch Menschen mit gleichem Bildungsstand und gleichem Einkommen weisen einen schlechteren Gesundheitszustand auf, wenn sie in sozioökonomisch stark benachteiligten Wohngegenden leben“, so Hoebel.
Mehrheit fühlt sich gesund
Zu den guten Nachrichten aus der RKI-Panelbefragung gehört aber auch, dass zwei Drittel der Menschen ihre Gesundheit als gut oder sehr gut einschätzen. Das verbleibende Drittel lässt sich Judith Fuchs zufolge auch mit der Demografie erklären: „Es hat uns nicht so sehr überrascht, denn es ist überall zu sehen, je älter die Menschen werden, desto mehr sind sie beeinträchtigt.“
Dazu kämen „Polikrisen“: Die Sorgen durch Klimawandel, Kriege und anhaltende Versorgungsdebatten machten den Menschen psychisch und körperlich zu schaffen. Aber auch bei der Einschätzung der allgemeinen Gesundheit zeigt sich eine deutliche soziale Schere. Nicht mal die Hälfte der geringer Gebildeten hält die eigene Gesundheit für gut. Besonders deutlich werden die Belastungen dort, wo junge Menschen in den Blick genommen werden. Mehr als ein Drittel der Befragten unter 29 Jahren berichtet über ein niedriges psychisches Wohlbefinden.
Mehr Datenpower in neuer Studie
Die neue RKI-Studienreihe „Gesundheit in Deutschland“ schließt eine große Lücke in der Überwachung der öffentlichen Gesundheit. Mehr als 40.000 Menschen ab 16 Jahren sind in dem Panel registriert und werden viermal im Jahr zu verschiedenen Indikatoren online und per Papierfragebogen befragt. Weil sie zufällig nach Daten der Einwohnermeldeämter ausgewählt wurden, lassen ihre Antworten feinkörnige statistische Erkenntnisse auf Wohnortebene zu – auch, um der Gesundheitspolitik eine bessere Grundlage liefern zu können.