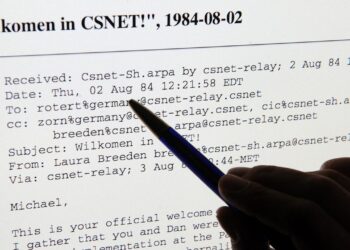Sicherheitsstrategie der Regierung „Der Weltraum militarisiert sich“
Stand: 19.11.2025 19:34 Uhr
Zum ersten Mal gibt es in Deutschland eine nationale Weltraumsicherheitsstrategie. Sie soll Kommunikations- und Navigationssysteme im All besser vor Störmanövern und Angriffen schützen – denn die nehmen immer weiter zu.

Ob beim Routenplaner, Handy oder im Flugverkehr: Ohne Satelliten geht heute nur noch wenig. Sie sind, so hat es Verteidigungsminister Boris Pistorius unlängst formuliert, die Achillesferse moderner Gesellschaften.
Umso wichtiger ist es aus Sicht der Bundesregierung, gemeinsam mit europäischen Partnern und Verbündeten mehr für ihren Schutz zu tun. Denn Störmanöver, macht der Minister klar, sind längst an der Tagesordnung: „Wir beobachten, dass Russland und China sich auch aufstellen, Einfluss zu nehmen auf andere Satelliten, also die von uns oder auch den Amerikanern. Das heißt: Der Weltraum militarisiert sich“, sagt Pistorius.
Wettrüsten ist nicht das Ziel
China und Russland haben ihre Fähigkeiten im All in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Sie sind in der Lage, andere Satelliten zu verfolgen und zu manipulieren, aber auch zu zerstören. Sich an diesem Wettrüsten, bei dem auch die USA mitmischen, zu beteiligen, sei jedoch nicht das Ziel, betont Pistorius:
Wir sind im All nicht offensiv unterwegs. Wir werden von uns aus keinen Satelliten einer anderen Nation – weder jetzt noch in Zukunft -attackieren oder attackieren lassen. Aber wir müssen in der Lage sein, uns auch offensiv im Sinne eines Gegenschlages wehren zu können, damit unsere Satelliten geschützt bleiben oder nicht weiter beschädigt werden, wenn es zu einem solchen Zwischenfall kommt.
Nationale Strategie auf knapp 50 Seiten
Was genau getan werden muss, was es alles zu bedenken gibt, das wurde in der ersten Nationalen Weltraumsicherheitsstrategie auf knapp 50 Seiten zusammengefasst. Es geht unter anderem um den Aus- und Aufbau europäischer Satellitennetze. Denn, so Pistorius, ohne Daten sei auch eine moderne Kampfführung heute nicht mehr denkbar.
Es geht aber auch um die Beschaffung neuer Trägerraketen, um Bodenstationen, Frühwarnsysteme, Radar und Teleskope. Und um einen vernetzten Ansatz: Ministerien, Industrie, Weltraumorganisationen, aber auch die Verbündeten, sollen mit an Bord geholt werden.
In der Weltraumstrategie der Bundesregierung geht es auch um Trägerraketen, Bodenstationen, Frühwarnsysteme, Radar und Teleskope.
Konkrete Ausgaben nennt Pistorius nicht
Aus Sicht der Wissenschaftlerin Antje Nötzold von der Technischen Universität Chemnitz, ist es eine Strategie, die diesen Namen auch verdient. „Zum einen haben wir wirklich ein realistisches Lagebild, Bedrohungswahrnehmung. Wir haben klare Ziele, die abgeleitet werden“, sagt Nötzold. „Und das Ganze ist idealerweise auch noch unterfüttert mit den angekündigten 35 Milliarden für militärische Weltraumfähigkeiten.“
Wofür konkret der Verteidigungsminister dieses Geld ausgeben will, darüber schweigt er sich aus militärischen Gründen aus. Nur so viel: Deutschland könnte demnächst auf kleinere, leichter auszutauschende Satelliten setzen – „um so eben auch den Innovationszyklen Rechnung zu tragen“, sagt Pistorius. Das sei ein Beispiel. Dafür werde eine Menge Geld ausgegeben, sagt der Minister. „Aber zum Beispiel eben auch für Softwarelösungen für den Schutz der Satelliten, die da sind oder neu hochkommen. Also das ist ein ganzes Paket.“
Minister kämpft für internationale Regeln
Es ist ein Bündel von Maßnahmen, das möglichst schnell angegangenen werden soll. Dazu gehört für den Verteidigungsminister auch, sich weiter stark zu machen für ein neues internationales Weltraum-Regelwerk. Denn das bestehende ist aus der Zeit gefallen. Es stammt aus dem Jahr 1967. Aus der Zeit, als Raumschiff Enterprise noch die unendlichen Weiten des Weltalls erforschte.