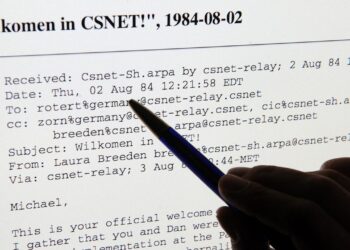Vermögen von G20-Milliardären gewachsen Oxfam beklagt wachsende Kluft zwischen Arm und Reich
Stand: 20.11.2025 07:09 Uhr
Die Hilfsorganisation Oxfam prangert wachsende Ungleichheit an: Milliardäre in den G20-Staaten seien in einem Jahr um insgesamt 2,2 Billionen US-Dollar reicher geworden – das sei genug, um Milliarden Menschen aus der Armut zu befreien.
Das Vermögen der Milliardäre in den G20-Staaten ist laut Oxfam binnen eines Jahres um 2,2 Billionen US-Dollar gewachsen. Damit könne man 3,8 Milliarden Menschen aus der Armut befreien, erklärte die Entwicklungsorganisation vor dem G20-Gipfeltreffen in Südafrika.
Oxfam beruft sich bei den Berechnungen auf Zahlen der Milliardärsliste des Wirtschaftsmagazins Forbes für die zwölf Monate bis Oktober 2025. Demnach konnten die Milliardäre in den G20-Ländern ihr Vermögen innerhalb eines Jahres um 16,5 Prozent von 13,4 auf 15,6 Billionen US-Dollar steigern.
Die jährlichen Kosten zur Bekämpfung der Armut der 3,8 Milliarden Menschen, die derzeit unterhalb der erweiterten Armutsgrenze der Weltbank von 8,30 US-Dollar pro Tag und Kopf leben, betragen den Angaben zufolge 1,65 Billionen Dollar.
Gremium gegen Ungleichheit gefordert
„Weltweit fügt die wachsende Ungleichheit der Menschheit schweren Schaden zu“, sagte Tobias Hauschild, Leiter des Bereichs Soziale Gerechtigkeit bei Oxfam. „Sie treibt Millionen Menschen in wirtschaftliche Not und befeuert zugleich politische Spaltung und den Niedergang der Demokratien.“
Der G20-Gipfel beginnt am Samstag in Johannesburg. Die Organisation forderte von Bundeskanzler Friedrich Merz und den anderen Staats- und Regierungschefs, sich für die Einrichtung eines internationalen Gremiums gegen Ungleichheit einzusetzen.
Außerdem sollten die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit zurückgenommen und Superreiche in die Pflicht genommen werden. „Es ist absolut inakzeptabel, dass Superreiche noch immer nicht angemessen besteuert werden, während gleichzeitig immer mehr Regierungen die Entwicklungszusammenarbeit zusammenstreichen“, sagte Hauschild. Auch die Bundesregierung sende mit ihren Kürzungen im Entwicklungsetat „ein fatales Signal“.