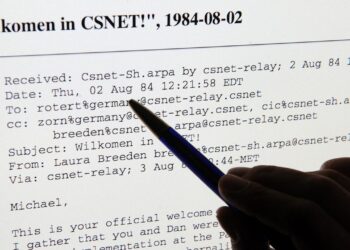Hightech-Agenda der Bundesregierung Mit Technologie die Wirtschaft retten?
Stand: 30.10.2025 11:27 Uhr
Die „Hightech Agenda Deutschland“ ist ein Prestigeprojekt aus dem Bundesforschungsministerium. Bei der Auftaktveranstaltung geht es um Tempo und das richtige Mindset. Doch reicht Geld aus Regierungsprogrammen aus?

Frank Fitzek steht im Foyer des Berliner Gasometers vor einer großen Kugel, in der sich etwas bewegt: Sechs Roboterarme bauen gemeinsam ein Modell zusammen. Fitzek ist Professor für Kommunikationsnetze an der TU Dresden und dort unter anderem für Start Ups zuständig. Eins davon, Evasive Robotics, hat diese kollaborativen Roboterarme entwickelt.
Der Clou: Früher musste man Robotern den immer gleichen Bewegungsablauf einprogrammieren, um beispielsweise ein Auto zusammenzubauen. In einer nahen Zukunft sollen die neuartigen Roboterarme selbst entscheiden, wie und mit welchen Arbeitsschritten sie das Auto zusammenbauen. Man sagt ihnen lediglich: Am Ende muss ein Auto rauskommen.
Durch Sensoren reagieren sie auf ihre Umwelt, man könnte als Mensch also auch mitbauen und mit dem eigenen Arm Werkstücke dazu packen oder wegnehmen. Das registriert das System, weicht dem menschlichen Arm aus und weiß auch, was dann noch gemacht werden muss und was nicht, erklärt Fitzek. Daran könne man sehen, dass das System wirklich adaptiv ist.
Neue Arbeitsplätze durch Start Ups?
Bei der Auftaktveranstaltung zur Hightech-Agenda drängen sich Deutschlands Visionäre, Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung mit vielversprechenden Ideen für die Zukunft. Das Ziel der „Hightech Agenda“: Deutschland soll zum führenden Standort für neue Technologien werden. Innovative Unternehmen sollen neue Arbeitsplätze schaffen und für wirtschaftliche Unabhängigkeit sorgen.
Sechs Schlüsseltechnologien hat das Forschungsministerium definiert, die es gezielt fördern will. Dazu zählen Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung sowie Technologien für klimaneutrale Mobilität. Wenn man den Macherinnen und Machern zuhört, erhascht man einen Hauch der technischen Möglichkeiten der Zukunft.
Zur Auftaktveranstaltung lässt sich neben Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) auch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sehen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sitzt auf dem Podium, sie alle haben inspirierende Beispiele mitgebracht.
Kanzler Merz will Daten mehr nutzen
Bundeskanzler Friedrich Merz hält eine Rede und meint, Deutschland sei in vielen Bereichen schon gut. Er erzählt, dass er kürzlich beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos von einem Microsoft-CEO ermutigt wurde. Die Deutschen wüssten gar nicht, welch ein Schatz die Daten der mittelständischen Industrie seien, man müsse sie nur nutzen.
„Und er hat mir den Rat mit auf den Weg gegeben: Sprecht ein bisschen weniger über Datenschutz und ein bisschen mehr über Datennutzung, dann könnt ihr viel besser sein“, sagt der Kanzler. Im Saal gibt es dafür Applaus.
Das richtige Mindset, die richtige Einstellung zum Fortschritt, das ist an diesem Tag auch immer wieder Thema. Deutschland sei ein versteckter Champion, meint Merz in seiner Rede.
Ministerin Bär will Innovationen kommerzialisieren
Eine Formulierung, die Forschungsministerin Bär später aufgreift. „Schrecklich“ findet sie das, kein Land der Welt verstecke seine Champions. Im Gegenteil, alle stellen sie „ins Schaufenster und sagen: Wir sind die Besten, die Größten, die Tollsten“. Nur Deutschland verstecke seine Champions, sagt Bär. Das sei ein Riesenproblem.
Auch schmunzelt Bär darüber, dass ihr persönlich immer wieder eine zu große Nähe zur Wirtschaft vorgeworfen werde, das könne sie nicht nachvollziehen. Es müsse in Deutschland normal werden, dass man Erfolge oder Innovationen auch kommerzialisiert, damit Geld verdient und darüber nicht die Nase gerümpft wird, so Bär.
Muss Deutschland Tempo machen?
Die meisten Anwesenden bei der Auftaktveranstaltung sehen die „Hightech Agenda Deutschland“ positiv. Beispielsweise Daniel Schall, er ist einer der Gründer von Black Semiconductor, ein Start Up aus Aachen, das neuartige Mikrochips entwickelt. Seit rund 20 Jahren arbeiten er und sein Bruder an ihrer Technik, vor wenigen Jahren haben sie das Start Up gegründet, das auch durch staatliche Programme gefördert wurde.
Schall findet, die Agenda setze genau den richtigen Impuls. Ob die finanzielle Ausstattung aber reicht, da ist er noch unsicher. Die größten Treiber der KI-Forschung in den USA geben hunderte Millionen dafür aus, sagt er – pro Tag. „Wenn wir mitspielen wollen, müssen wir in ähnlichen Dimensionen denken und nicht zögern, sondern jetzt umsetzen“, sagt der Gründer. International sei Deutschland nicht abgehängt, aber es müsse jetzt Tempo machen.
Bei den neuesten Technologien dabei zu sein, sei nicht zuletzt auch mit Blick auf die Rente entscheidend, findet Schall. Das Rentenkonzept basiere auf der Idee der Wertsteigerung von Arbeit. Deutschland brauche neue Branchen, um das Sozialsystem zukunftsfest aufstellen zu können.
Das meiste Geld kommt aus der Privatwirtschaft
Professor Frank Fitzek von der TU Dresden denkt eher an den Fachkräftemangel der Gegenwart. Seine kollaborativen Roboterarme sieht er primär in kleineren mittelständischen Betrieben wie Bäckereien. Viele Bäcker sagen, sie würden niemanden mehr finden, der nachts um 3 Uhr aufsteht, um Teiglinge auf ein Band zu legen. Eine einfache Aufgabe, die auch einer seiner Roboterarme übernehmen könne. Ein zweiter würde vielleicht eine Brezel formen, ein dritter Salz darüber streuen.
Die Roboterarme lernen vom Zuschauen, ein Mensch kann ihnen vormachen, was sie tun sollen, sie adaptieren das. Deswegen sei das für den Bäcker auch kostengünstig, erklärt Fitzek. Theoretisch könnte ein Roboterarm innerhalb kurzer Zeit umgestellt werden von Brezel auf Croissant, ohne, dass dafür weitere Kosten entstehen.
Ob für die Zukunft oder die Gegenwart: Für die Hightech-Agenda hat das Bundesforschungsministerium bisher 18 Milliarden Euro für mehrere Jahre veranschlagt. Allerdings kommt sowohl in den USA als auch in Deutschland das meiste Geld für Innovationen aus der Privatwirtschaft, nicht aus Regierungsprogrammen.