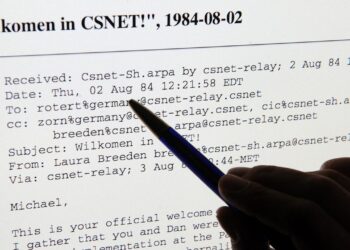faq
Koalitionsausschuss Was sich beim Bürgergeld ändern soll
Stand: 09.10.2025 10:50 Uhr
Das Bürgergeld ist bald Geschichte, künftig heißt es Grundsicherung. Der Koalitionsausschuss hat sich zudem auf strengere Regeln geeinigt. Was wird gelten? Und warum soll es die Änderungen geben? Ein Überblick.
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Spitzen von Union und SPD auf Verschärfungen beim Bürgergeld geeinigt. Die neue Grundsicherung werde kommen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin. „Wir werden die Mitwirkungspflichten deutlich verstärken, wir werden auch die Sanktionsmöglichkeiten deutlich erhöhen“, so der CDU-Politiker.
Die etwa 5,5 Millionen Bürgergeld-Beziehenden müssen sich nun auf strengere Auflagen einstellen. Dem Durchbruch im Koalitionsausschuss waren intensive Gespräche von Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas vorausgegangen.
Was soll sich ändern?
Mit den Änderungen sollen Teile der Anfang 2023 in Kraft getretenen Bürgergeld-Reform rückabgewickelt werden. Die Leistung soll künftig einfach nur noch „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ heißen. Im Zentrum stehen Verschärfungen, die die Pflichten der Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen stärker hervorheben.
Konkret soll mit härteren Sanktionen belegt werden, wer gegen die Regeln der Jobcenter verstößt, etwa bei Terminen oder der Arbeitsaufnahme. Wer als Empfänger von Grundsicherung einen ersten Termin im Jobcenter versäumt, soll sofort zu einem zweiten Termin eingeladen werden. Wer diesen Termin ebenfalls nicht wahrnimmt, dem soll die monatliche Überweisung um 30 Prozent gekürzt werden. Bleibt auch ein dritter Termin ungenutzt, sollen die Geldleistungen komplett eingestellt werden.
Alle Leistungen inklusive der Unterstützung zur Unterkunft sollen für diejenigen gestrichen werden, die auch im Monat darauf nicht erscheinen. „Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben“, sagte SPD-Politikerin Bas. „Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.“ Härtefälle würden dabei berücksichtigt, sagte sie.
Auch das Vermögen der Betroffenen soll weniger geschont werden und Karenzzeiten sollen wegfallen. Das Schonvermögen soll stattdessen an die Lebensleistung geknüpft werden.
Warum hat sich Schwarz-Rot am Bürgergeld gestört?
18 Jahre nach dem Start des damals umgangssprachlich Hartz IV genannten Systems hatte das Bürgergeld die Regeln für Langzeitarbeitslose und Bedürftige vor zwei Jahren teils entschärft. Arbeitslose sollten weniger gegängelt, ihnen sollte mehr geholfen werden.
Die Bürgergeldreform galt als wichtigste Sozialreform der Ampelkoalition. Doch noch während ihrer Regierungszeit gab es vor allem aus den Reihen der Union immer wieder Kritik am Bürgergeld. Hauptkritikpunkte: Es gehe dabei nicht immer gerecht zu, Mehrarbeit würde sich oft nicht lohnen, Regelverstöße würden zu lasch behandelt.
„Wer arbeitet, muss erkennbar mehr bekommen als jemand, der nicht arbeitet“, hatte etwa CSU-Chef Markus Söder im Einklang mit vielen Unionspolitikern gefordert. Im Koalitionsvertrag einigten sich Union und SPD dann auf Reformansätze, die Rechte und Pflichten verbindlich regeln sollen.
Die Union verspricht sich auch Einsparungen durch strengere Regeln bei der Grundsicherung. „Es sind sehr viele Milliarden, da bin ich mir ganz sicher“, sagte etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntagabend im ZDF. Kanzler Merz äußerte sich in der ARD-Sendung Caren Miosga vorsichtiger. Er verwies darauf, dass man pro 100.000 Menschen, die man aus dem Bürgergeld zurück in den Arbeitsmarkt holen, etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro spare. Zuvor hatte er eine Gesamtsumme von 5 Milliarden Euro ins Spiel gebracht.
Welche Reaktionen gibt es auf die Pläne?
Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplante Verschärfung beim Bürgergeld deutlich. „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete der Nachrichtenagentur dpa. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.
Dieser ziele nicht nur auf die Beziehenden des Bürgergelds, sondern auch auf arbeitende Menschen, so Reichinnek. „Für sie ist das Signal klar: Fordert keine besseren Arbeitsbedingungen, nehmt jede Überstunde hin, auch wenn ihr sicher seid, dass sie am Ende unbezahlt bleibt, fordert keinen besseren Lohn – denn im Bürgergeld wird es noch wesentlich schlimmer.“
Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hofft nun auf den Startschuss für eine „echte Erneuerung“ des Sozialstaats. „Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben“, erklärte Dulger. Daran müsse sich die angekündigte Reform zur Stärkung von Arbeitsanreizen anschließen. „Die Sozialstaatskommission steht in der Verantwortung, bis Jahresende ein belastbares Fundament zu legen.“
Der Präsident des Großhandelsverbands BGA, Dirk Jandura, begrüßte die Ergebnisse des Koalitionsausschusses: „Endlich geht es voran“, sagte er. Beim Bürgergeld sei die Rückkehr zum Prinzip Fördern und Fordern der richtige Schritt.
Wie hoch ist das Bürgergeld?
Das Bürgergeld soll das verfassungsrechtlich gesicherte Existenzminimum etwa für Langzeitarbeitslose gewähren. Alleinstehende erhalten derzeit 563 Euro im Monat. Kinder erhalten je nach Alter 357 bis 471 Euro.
Im kommenden Jahr soll es die zweite Nullrunde in Folge geben, nachdem die Regelsätze 2023 und 2024 inflationsbedingt deutlich erhöht worden waren.
Was sagt das Verfassungsgericht zur Höhe der Leistungen?
In einem Grundsatzurteil verwies das Bundesverfassungsgericht 2019 auf das Grundgesetz: Die Ausgestaltung der Grundsicherung ergibt sich demnach aus dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Denn staatliche Verpflichtung ist es, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Der Staat hat folglich den Auftrag, die Voraussetzungen für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen.
Seine sozialen Leistungen darf er daran knüpfen, dass Menschen ihre Existenz nicht selbst sichern können – und darf aktive Mitwirkung einfordern. Auch Sanktionen sind erlaubt. Aber der Staat muss dabei laut Karlsruhe strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit beachten. Nicht zu beanstanden ist laut den Richtern eine Leistungsminderung von 30 Prozent, bis ein Betroffener wieder mitwirkt.
Darf der Staat die Grundsicherung vollständig streichen?
Das Bundesverfassungsgericht setzt dem enge Grenzen. Der vollständige Wegfall ist „auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse mit den verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht vereinbar“, heißt es im Urteil. „Es liegen keine tragfähigen Erkenntnisse vor, aus denen sich ergibt, dass ein völliger Wegfall von existenzsichernden Leistungen geeignet wäre, das Ziel der Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit und letztlich der Aufnahme von Erwerbsarbeit zu fördern.“
Welche Mitwirkungspflichten gibt es aktuell?
Den Antrag auf Bürgergeld muss man persönlich stellen. Alle Angaben müssen korrekt gemacht, Urkunden und Bescheinigungen vorgelegt, Änderungen mitgeteilt werden. Wird man krank, muss man am dritten Tag ein Attest vorlegen.
Bürgergeld-Empfänger müssen an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitwirken und sich auf Verlangen bewerben. Es gilt die Verpflichtung, jede zumutbare Arbeit anzunehmen, zu der man in der Lage ist.
Wie viele „Totalverweigerer“ gibt es?
Wie viele „Totalverweigerer“ es gibt, kann die Bundesagentur für Arbeit nicht erfassen. „Wir können statistisch nicht auswerten, wie oft eine Minderung festgestellt wurde, weil jemand eine Arbeit abgelehnt hat“, sagte ein Sprecher gegenüber tagesschau.de im März 2024.
Statistisch erfasst werde aber der Minderungsgrund „Weigerung Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses“, bei dem auch Weiterbildungen und Qualifikationen berücksichtigt werden. In den vergangenen zwölf Monaten (Stand: September 2025) haben die Jobcenter gut 25.000 Leistungsminderungen aus diesen Gründen ausgesprochen.