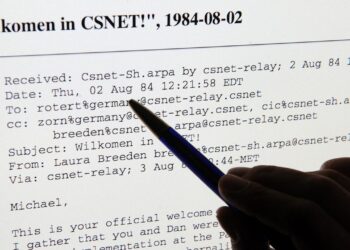Stand: 18.11.2025 18:59 Uhr
Wie kann Europa in der digitalen Technologie unabhängiger von den US-Konzernen werden? Darüber haben Kanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und Minister aus anderen EU-Staaten beim Digitalgipfel beraten.
Hochrangige Vertreter Deutschlands, Frankreichs und der EU haben sich zu einem Digitalgipfel in Berlin getroffen – und dabei betont, dass Europa sich stärker unabhängig bei digitalen Technologien machen müsse.
Bundeskanzler Friedrich Merz sprach sich auf dem deutsch-französischen Gipfel für eine starke Rolle Europas in der digitalen Welt aus. Tektonische Verschiebungen erforderten schnelles Handeln im digitalen Raum, sagte der CDU-Politiker vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Merz fordert Innovationsführerschaft
Europa müsse in vereinter Kraftanstrengung einen eigenen digitalen Weg gehen, sagte Merz. „Und dieser Weg muss in die digitale Souveränität führen – jedenfalls überall dort, wo es notwendig und wo es erreichbar ist.“ Europa setze auf Offenheit und wolle keine virtuellen Mauern bauen. Klar sei aber auch, Europa werde „digitale Souveränität nicht politisch herbeiregulieren oder herbeisubventionieren“ können, sagte Merz. Man müsse sie gemeinsam mit der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft gestalten.
Um die digitale Souveränität zu erreichen, müsse Europa digitale Fähigkeiten entwickeln. „Um im Wettbewerb um digitale Technologien zu bestehen, brauchen wir Innovationsfähigkeit. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir brauchen Innovationsführerschaft“, sagte der Kanzler.
Ein Spielball der USA und Chinas?
Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron warnten, dass Europa sonst zum Spielball der beiden Supermächte werde.
Macron warnte beispielsweise davor, dass die Europäer ihre Kinder täglich vier bis fünf Stunden in die Verantwortung von US-amerikanischen oder chinesischen Plattform-Anbietern geben würden, die nicht unbedingt das Wohl der Europäer im Auge hätten. Er sprach von einer „kognitiven Souveränität“.
EU sehr gut aufgestellt
Sowohl Merz als auch Macron verwiesen darauf, dass die EU mit dem Binnenmarkt, 450 Millionen Konsumenten, vielen Experten und Wissenschaftsorganisationen eigentlich sehr gut für die Aufholjagd auf die USA und China aufgestellt sei.
Gleichzeitig kritisierte Macron, dass die EU die Regulierung im KI-Bereich überzogen habe. „Wir müssen Dinge erst einmal erfinden, bevor wir sie regulieren“, mahnte er.
Eigene KI-, Software- und Cloudprodukte
Doch wie können sich Verwaltung und Unternehmen in Europa mit eigenen KI-, Software- und Cloud-Produkten aus der Abhängigkeit mächtiger Firmen wie Google, Amazon, Microsoft befreien? Die Frage hat sicherheitspolitische Bedeutung, denn wer die Software hat, die Clouds, in denen die Daten abgelegt werden und die KI, die damit arbeiten kann, hat mächtige Hebel in der Hand.
Merz sagte weiter: „Wir sehen die systemische Rivalität der USA und Chinas, zweier Großmächte, auch zweier Digitalgroßmächte, die um die Technologieführerschaft ringen. Europa darf ihnen dieses Feld nicht überlassen.“ Er verwies auf die Störungen bei großen US-Cloud-Anbietern und die chinesischen Lieferengpässe bei Chips. „Diese Störungen zeigen: Wir sind abhängig von digitalen Technologien, sowohl aus China als auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika“, warnte er.
Deshalb müssten Deutschland und die EU aufholen. Das betreffe insbesondere die Schlüsseltechnologien von Künstlicher Intelligenz über Quantentechnologie und Cloud-Computing bis hin zur Mikroelektronik, fügte der Kanzler hinzu. Nur so schaffe man Alternativen und eben auch Wahlmöglichkeiten. Auch die Bundeswehr und Behörden müssten in der Lage sein, Cyberangriffe und Desinformation mit eigenen technologischen Mitteln abzuwehren. Bisher dominieren in diesem Bereich etwa US-amerikanische oder israelische Programme.
Staat als „Ankerkunde“
Eine weitere Überlegung auf dem Gipfel: Der Staat als Ankerkunde, also als Kunde, der Technologie von heimischen Unternehmen nutzt, damit diese wachsen und sich durchsetzen können. Schleswig-Holstein tut das beispielsweise und ersetzt in der Verwaltung Microsoft-Programme wie Outlook, Excel oder Word durch andere Systeme.
Merz kündigte an, dass der Staat sogenannter Ankerkunde europäischer Digitalanbieter werde und unter anderem Software von US-Firmen ersetzen werde. „Denn der Staat muss seine Arbeit auch in Krisenzeiten stabil ausführen können“, betonte Merz. Erste Behörden wie das Robert Koch-Institut seien bereits umgestiegen. Auch im Bundeskanzleramt würden Komponenten aus OpenDesk, also offener Software, genutzt. Er kündigte an, dass Deutschland und Frankreich gemeinsame Kriterien für die Beschaffung souveräner digitaler Dienste entwickeln wollen. Die nächste Generation von KI soll auch in Europa gestaltet werden.
Kooperationen und Investitionen von Unternehmen?
Im Zuge des Gipfels wurden außerdem zahlreiche Ankündigungen für Kooperationsvereinbarungen und Investitionen deutscher und französischer Unternehmen erwartet. Das Treffen mit etwa 1.000 Gästen sollte einen Aufschlag machen, damit Europa hier schneller mit eigenen Lösungen vom Fleck kommt. Die Antreiberrolle fiel Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) zu: Europa raus aus der Zuschauerrolle, digitales Comeback mit KI, der Gipfel als Signal des Aufbruchs waren Kernthemen seiner Rede.