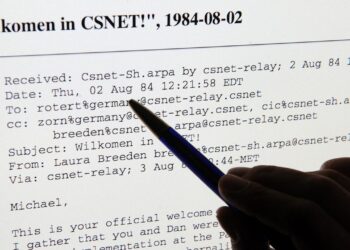analyse
Lage der deutschen Wirtschaft Eine Woche zum Vergessen
Stand: 31.10.2025 16:42 Uhr
Vor knapp einem Jahr zerbrach die Ampel wegen der schlechten Wirtschaftslage und dem Streit über Gegenmittel. Heute ringt die neue Regierung mit denselben Problemen – und das Umfeld ist noch schwieriger geworden.

Es war so eine Woche zum Vergessen – beim Blick auf die Wirtschaftslage. Volkswagen ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Mit gut einer Milliarde Euro Verlust im dritten Quartal. Die saisonübliche Belebung am Arbeitsmarkt ist weitgehend ausgeblieben. Und die eigentliche Zahl der Woche lautet 0,0 Prozent. Das ist die erste Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal – also in den Monaten Juli, August und September im Vergleich zu den drei Vormonaten.
„Die deutsche Wirtschaft befindet sich ohne Zweifel weiter in einem schwierigen Fahrwasser. Das haben die Zahlen noch mal bestätigt“, kommentiert etwas zerknirscht der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Nach zwei Jahren Rezession 2023 und 2024 kommt die Konjunktur einfach nicht in Schwung. Die zähe Krise dauert an. Erst für das kommende Jahr rechnen Wirtschaftsforscher mit einem leichten Aufschwung.
Dabei waren Bundeskanzler Friedrich Merz und seine schwarz-rote Regierung erklärtermaßen angetreten, die Stimmung bis zum Sommer aufzuhellen und damit auch der Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen. Aber der Konsum ist nur schwach, die Bürger halten ihr Geld zusammen. Und die wichtige deutsche Exportindustrie verliert weiter an Marktanteilen.
Wirtschaftsverbände und Ökonomen verweisen seit langem auf hausgemachte Ursachen für das ausbleibende Wachstum. Vergleichsweise hohe Steuern für Unternehmen, viel Bürokratie und Berichtspflichten, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in vielen Branchen, hohe Energiepreise und wachsende Kosten für die Sozialversicherungen.
Unübersehbar wurde in dieser Woche aber auch, wie sich das internationale Umfeld inzwischen verändert hat. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche beschrieb die Lage am Dienstag beim Außenwirtschaftstag recht düster.
Die wirtschaftsliberale Weltordnung, wie wir sie kannten, gehört langsam aber sicher der Vergangenheit an.
Jahrzehntelang hatte Deutschland profitiert von sich immer stärker öffnenden Weltmärkten – vor allem Fahrzeuge, Maschinen und chemische Produkte in alle Welt verkauft. Und umgekehrt kam der deutschen Wirtschaft zugute, dass sie viele Vorprodukte und Energie günstig aus anderen Ländern beschaffen konnte.
Jetzt schlägt das Pendel in eine ganz andere Richtung. US-Präsident Donald Trump hat den offenen Märkten den Kampf angesagt, bringt Deutschland und Europa mit hohen Zöllen in Bedrängnis. Und während Russland schon kurz nach dem Großangriff auf die Ukraine 2022 den Gashahn nach Deutschland zugedreht hat, dämmert nun vielen, dass die deutsche Wirtschaft in manchen Feldern auch von China enorm abhängig ist. Insbesondere bei seltenen Erden und bedingt auch bei Halbleitern.
Märkte zwischen den Fronten China und USA
Die offenen Märkte geraten nun in den Würgegriff des geopolitischen Machtkampfes zwischen China und den USA. Das Treffen der beiden Präsidenten Trump und Xi Jinping dürfte zwar zu einer leichten und befristeten Lockerung der chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden führen. Aber was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, ist immer noch nicht klar.
„Uns liegen noch keine genaueren Informationen dazu vor, wie diese angekündigten Schritte konkret umgesetzt werden sollen“, erklärt der Sprecher des Wirtschaftsministeriums Tim-Niklas Wentzel.
Trump hatte beim Treffen mit Xi festgestellt, dass die Führer der beiden größten Wirtschaftsmächte zusammengekommen sind. Die dritte große Wirtschaftsmacht Europa hat erkennbar an Bedeutung verloren und muss sehen, was für sie vom Verhandlungstisch abfällt. Eine bittere Erkenntnis in dieser Woche.
Treffen mit Vertretern der Stahlindustrie
In der kommenden Woche will sich die Bundesregierung einer Branche zuwenden, die besonders leidet. Kanzler Friedrich Merz und Vize-Kanzler Lars Klingbeil wollen im Kanzleramt mit den führenden Vertretern der Stahlindustrie zusammenkommen. Die ist erheblich unter Druck geraten durch günstigeren Stahl aus China oder Indien. Gleichzeitig soll die Branche mit staatlichen Fördermitteln den klimagerechten Umbau voranbringen. Aber der Stahlriese Arcelor Mittal hat im Juni seine Pläne für die Produktion von sogenanntem grünen Stahl in den Werken Bremen und Eisenhüttenstadt gestoppt. Zu teuer, zu schwierig die Lage auf dem Weltmarkt, so das Unternehmen.
Der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hatte irgendwann Routine darin, die wiederkehrenden schlechten Quartalszahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zu erklären.
Seine Nachfolgerin, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU, hat nach Veröffentlichung der Quartalszahlen gar nicht erst eine eigene Pressemitteilung verschicken lassen – nur gegenüber der Nachrichtenagentur dpa angedeutet, dass sie weitergehende Reformen für notwendig hält als die bislang auf den Weg gebrachten. Bereits beschlossen: steuerliche Erleichterungen für Unternehmen, die investieren und die Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe ab Januar.
Zudem setzt die Bundesregierung auf das schuldenfinanzierte Sondervermögen, mit dem der Staat in den kommenden zehn Jahren 500 Milliarden Euro vor allem in die öffentliche Infrastruktur stecken will. „Wir setzen alles daran, Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen“, so Vize-Regierungssprecher Meyer. Er verweist darauf, dass viele Maßnahmen ihre Wirkung erst entfalten müssten. Der Versuch etwas Optimismus zu verbreiten – am Ende einer Woche, die eher zum Vergessen war.
Mehr zu diesem Thema hören Sie im Podcast Berlin Code.