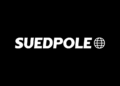Als der Laboringenieur John P. Pytlak im Jahr 2001 einen Oscar für eine seiner Entwicklungen entgegennahm, die er für den Kamerahersteller Kodak erarbeitet hatte, eröffnete er seine Dankesrede nicht nur mit einem wortspielreichen Gedicht. Er hatte auch das Foto einer Frau mitgebracht, bei der er sich bedankte. Das Bemerkenswerte daran: Auf dem Bild war weder seine Ehefrau noch eine Kollegin abgebildet, sondern eine Fremde, deren Namen er nicht kannte.
Deshalb nannte er sie nur bei ihrem Spitznamen: Die dunkelhaarige Frau mit dem vorsichtigen Lächeln ist als „Kodak LAD Girl“ in die Filmgeschichte eingegangen. Auf wie vielen Filmkopien sie verewigt wurde, ist kaum zu ermitteln – es müssen Tausende sein. Und trotzdem hat vermutlich kaum ein Filmfan sie jemals gesehen.
Auftritt Quentin Tarantino. Der Filmemacher und bekennende Film-Nerd hat bekanntermaßen Spaß an obskuren und kryptischen Referenzen – und wer genau hinschaut, erkennt das LAD Girl in einer kurzen Sequenz wieder: Im Abspann des Action-Thrillers „Death Proof – Todsicher“ ist zum Song „Chick Habit“ ein unkommentierter Zusammenschnitt von Frauenporträts zu sehen, der selbst bei eingefleischten Tarantino-Fans erst mal Schulterzucken auslöste.
In Filmforen wurde damals wild gerätselt, was es damit auf sich haben könnte. Die entscheidenden Hinweise kamen schließlich von Filmvorführern und Mitarbeitern aus Filmlaboren: Es handle sich um sogenannte „China Girls“ – ein Begriff, der sich über die Jahrzehnte für Testbilder eingebürgert habe, die in den Filmlaboren genutzt werden, um bei der Entwicklung von Filmmaterial die Farb- und Helligkeitswerte kontrollieren zu können.
Als Models dienten den Laboren oft eigene, junge Mitarbeiterinnen
Als Endverbraucher kennt man das von früher aus dem Fernsehen in Form von Farbbalken, mithilfe derer man den Bildschirm einstellen kann. Für analoges Filmmaterial drehten die Labore bereits seit den 1920er-Jahren ähnliche Testbilder, um zunächst die Graustufen und später auch die Farben des finalen Films daran auszurichten. Diese fügten sie in das Startband der einzelnen Filmrollen ein – jene Sekunden vor dem Vorspann, in dem für die Filmvorführer ein Countdown bis zum eigentlichen Start des Films eingeblendet wird.
Schon früh handelte es sich bei den Testbildern nicht ausschließlich um Farbbalken. Oft wurden auch Personen in einer Porträt-Ansicht ins Bild gesetzt, um die Natürlichkeit der Farben schnellstmöglich zu erkennen. Denn in einem menschlichen Gesicht sieht man auf den ersten Blick, ob das Bild beispielsweise über- oder unterbelichtet ist oder die Farbstufen einen unnatürlichen Teint erzeugen.
Über Jahrzehnte hinweg arbeitete nahezu jedes Filmlabor mit eigenen Testbildern – entsprechend viele unterschiedliche Porträts entstanden über die Jahre. In den meisten Fällen von jungen Frauen. Vorwiegend holte man unbekannte Models oder aus praktischen Gründen einfach gleich Mitarbeiterinnen der Labore selbst vor die Kamera.
Persönlichkeitsrechte? Wurden damals vermutlich eher vernachlässigt, denn die Bilder waren ja nur für den internen Gebrauch bestimmt. Lediglich die eigenen Mitarbeitenden und die Filmvorführer bekamen sie zu Gesicht. Doch offenbar entwickelte sich auf dieser für das Publikum unsichtbaren Seite Hollywoods eine regelrechte Fangemeinde, die möglichst viele der Frauenporträts sammeln wollte.

Dem Geheimnis auf der Spur
Dem Geheimnis auf der Spur
:Der seltsame Strauch
Die Naturforscherin Marianne North reiste vor 200 Jahren allein um die Welt – und hielt Flora und Fauna in detailgenauen Bildern fest. Noch heute können Wissenschaftler damit unbekannte Pflanzen bestimmen. Wer war diese ungewöhnliche Frau?
Weshalb die Porträts als „China Girls“ in die Filmgeschichte eingingen, ist nicht eindeutig überliefert: In den seltensten Fällen waren es asiatische Frauen, die hier gefilmt wurden – das Filmgeschäft war lange von Weißen geprägt, die helle Hauttöne als Norm voraussetzten. Erst spät begannen einige Labore, auch andere Hautfarben zu berücksichtigen. Womöglich hat sich der Begriff „China“ im Sinne von „Porzellan“ festgesetzt – zu Beginn der Praxis waren tatsächlich immer wieder Porzellanköpfe abgefilmt worden.
Auch John Pytlak geht in Forumsbeiträgen davon aus, dass diese Geschichte die wahrscheinlichste ist. Ein Forschungsprojekt der Chicago Film Society wertet diese überlieferten Storys und Erzählungen aus – und archiviert die Bilder unter dem weniger diskriminierenden Begriff „Leader Ladies“, wobei mit „leader“ das Startband gemeint ist, in dem die Porträts jeweils erscheinen.
Pytlaks Dankesrede war vermutlich der erste – wenn auch nicht persönliche – öffentliche Auftritt einer Leader Lady. Für den Labortechniker und seine Kollegenschaft jedoch war sie ein vertrauteres Gesicht als sämtliche Hollywood-Stars und Sternchen. Sie sei wohl mittlerweile eine Großmutter, erzählte er in seiner Rede, doch für ihn bleibe sie ewig so jung wie auf diesem Bild. In gewisser Weise war das „LAD Girl“ ein Star unter den „Leader Ladies“, dank Pytlaks Entwicklung, für die er schließlich geehrt wurde: das „Laboratory Aim Density“, kurz: LAD-System.
Um den Prozess auch für Laien verständlich zu erklären, hatte Pytlak Mitte der 1970er-Jahre für den Pitch bei seinen Chefs ebenjenes Gedicht geschrieben, das er nun ein Vierteljahrhundert später erneut vortrug. Grob gesagt hat er ein standardisiertes Verfahren erarbeitet, um die Qualitätskontrolle der Farb- und Helligkeitswerte bei der Entwicklung von analogem Filmmaterial zu vereinfachen. Somit war es erstmals möglich, dass jedes beliebige Labor dieselben Ergebnisse erzielen konnte, unabhängig davon, ob es für einen bestimmten Hersteller von Filmmaterial zertifiziert war oder nicht. Das „LAD Girl“ wurde somit zum Goldstandard, der sich bis in die Digitalisierung des Filmgeschäfts hinein hielt.