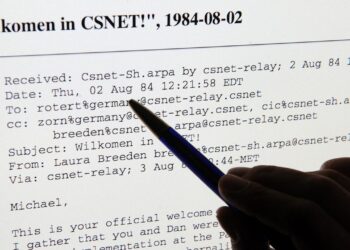hintergrund
Kompromiss von Schwarz-Rot Was sehen die Pläne für den Wehrdienst vor?
Stand: 13.11.2025 11:46 Uhr
Schon ab dem kommenden Jahr soll das geplante Gesetz für den neuen Wehrdienst in Kraft treten. Doch wie soll der aussehen? Und für wen soll er gelten? Ein Überblick.
Verpflichtende Musterung
Mit dem geplanten Gesetz soll die sogenannte Wehrerfassung wieder eingeführt werden. Dafür sollen künftig alle 18-jährigen Frauen und Männer einen Fragebogen erhalten, in welchem sie angeben, ob sie den Wehrdienst absolvieren wollen und sich dafür geeignet sehen. Für Männer ist die Beantwortung des Fragebogens verpflichtend.
Ebenso wird für alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, die Musterung wieder zur Pflicht. Die verpflichtenden Musterungen sollen Angaben des Bundesverteidigungsministeriums zufolge ab dem 1. Juli 2027 erfolgen. Bei der Musterung wird geprüft, ob der- oder diejenige für den Wehrdienst geeignet ist, sowohl in Hinsicht auf körperliche als auch geistige Voraussetzungen. Die Musterung dient lediglich der Erfassung der Wehrdiensttauglichkeit, sie ist noch keine Verpflichtung.
Prinzip Freiwilligkeit
Ziel der Bundesregierung ist es, die Bundeswehr durch Freiwillige aufzustocken. Die Zielmarke sind mindestens 260.000 Männer und Frauen in der Truppe – ein Plus um etwa 80.000 Kräfte. Zudem soll es 200.000 Reservisten geben.
Schwarz-Rot hofft, dass sich genügend Freiwillige für den Wehrdienst melden, um dieses Ziel zu erfüllen. So heißt es im gemeinsamen Beschlusspapier von CDU, CSU und SPD auch explizit: „Der freiwillige Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement bleibt erhalten.“
Die Koalition will den freiwilligen Dienst attraktiv machen – durch ein geplantes Gehalt von rund 2.600 Euro brutto pro Monat. Wer sich für mindestens zwölf Monate auf Zeit verpflichtet, erhält den Status Soldat auf Zeit und kann damit zusätzliche Förderung bekommen, etwa einen Zuschuss für den Pkw- oder Lkw-Führerschein.
Bedarfswehrpflicht und Losverfahren
Sollten sich über den Weg der Freiwilligkeit nicht genügend neue Kräfte für die Bundeswehr finden, kann den Gesetzesplänen zufolge die sogenannte Bedarfswehrpflicht greifen. Laut dem schwarz-roten Beschlusspapier dient sie dazu, mögliche Lücken „zwischen dem Bedarf der Streitkräfte und der tatsächlichen Zahl an Freiwilligen“ zu schließen.
Sie wird jedoch nicht automatisch aktiviert, sondern bedarf eines gesonderten Gesetzesbeschlusses des Bundestages. Das Parlament müsste mehrheitlich für die Einführung der Bedarfswehrpflicht stimmen, vorausgesetzt die verteidigungspolitische Lage oder die Personalsituation der Truppe machen diesen Schritt erforderlich.
Macht der Bundestag den Weg frei, soll dann „ein Zufallsverfahren zur Auswahl“ weiterer Wehrdienstleistender greifen. CDU, CSU und SPD betiteln diese Maßnahme im gemeinsamen Kompromiss aber als „ultima ratio“, also als letzten möglichen Schritt, und betonen: „Einen Automatismus zur Aktivierung der Wehrpflicht wird es nicht geben.“
Ausbau der zivilen Freiwilligendienste
Parallel zur Stärkung der Bundeswehr sollen auch die zivilen Freiwilligendienste ausgebaut werden. Dafür werden im kommenden Jahr 50 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt, ab 2027 sind 80 Millionen Euro jährlich vorgesehen. Damit sollen mehr als 15.000 neue Plätze geschaffen werden, etwa in Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen sowie im Klima- und Katastrophenschutz.
Ziel ist es, dass sich jährlich mehr als 100.000 junge Menschen in einem Freiwilligendienst engagieren. Die zusätzlichen Mittel sollen es den Trägern zudem ermöglichen, die Vergütung für die Freiwilligen zu erhöhen.
Ab wann soll das neue Gesetz gelten?
Geplant ist, dass das neue Gesetz zum Wehrdienst schon ab Beginn des kommenden Jahres in Kraft tritt. Dafür muss es noch durch den Bundestag. Stimmt dieser zu, wird anschließend der Bundesrat über das Gesetz beraten.