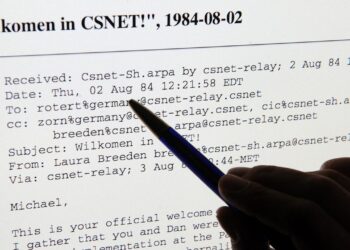Reportage
Valencia gedenkt der Flut Viele Fragen in der „Zone Null“ der Überschwemmung
Stand: 29.10.2025 20:30 Uhr
Ein Jahr nach den verheerenden Überschwemmungen vor allem rund um Valencia hat Spanien am Abend der 237 Opfer gedacht. Wie sieht es heute in der „Zone Null“ der Katastrophe aus – und welche Konsequenzen wurden gezogen?

Kerzen säumen in der einbrechenden Dunkelheit in Paiporta den Poyo-Graben, das trockene Bett des Flusses Poyo. Ein stilles Gedenken von Anwohner und Angehörigen der Menschen, die umkamen, als Wassermassen den Poyo-Graben und die umliegenden Vorstädte Valencias schlagartig überfluteten.
Die Stadtteile rechts und links dieses Grabens bilden die „Zona cero“, die Zone Null der katastrophalen Überflutung. „20:11“ – die Uhrzeit der viel zu späten Warnung der Bevölkerung – steht symbolisch auf einem Blumenkübel auf dem Fußweg. Und: „Vergesst nicht! Verzeiht nicht!“
Denn als die Alarm-Meldung auf den Handys landete, war der Poyo längst über die Ufer getreten, hatte Straßen, Parkhäuser und Erdgeschosse überflutet, Menschen und Autos mitgerissen. Die Wut darüber mobilisierte vor dem Jahrestag erneut 50.000 Menschen zum Protest, vor allem gegen den Regionalpräsidenten, der in den kritischen Stunden abwesend war. 20:11 steht mahnend auf den T-Shirts vieler Demonstrantinnen und Demonstranten.
Die Erinnerung an den Beginn der Katastrophe von 2024 ist immer da – und wird auch auf Blumenkübeln festgehalten.
Verbesserungen beim Warnsystem
Seit den dramatischen Überflutungen vor einem Jahr sind die Behörden in ganz Spanien höchst sensibilisiert. Ein lautes anhaltendes Dröhnen auf dem Handy – dieses Signal schreckte in den Monaten danach immer wieder viele Menschen auf und warnte sie vor einem nahenden Unwetter.
Vor einem Jahr hatte die staatliche Wetter-Agentur AEMET zwar das Wetterphänomen „Kaltlufttropfen“ vorhergesagt und rote Warnmeldungen für die später betroffenen Regionen veröffentlicht. Trotzdem sah sie anschließend Optimierungsbedarf. Jetzt veröffentlicht sie ihre Warnungen noch früher und benennt Gefahren noch deutlicher.
Rubén del Campo, Sprecher von AEMET, nimmt jetzt bei der spanischen Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für die Bedeutung roter Warnungen wahr. Der spanischen Tageszeitung El País erklärt er, die eigentliche Herausforderung bestehe darin, dieses Bewusstsein „über die Jahre hinweg aufrechtzuerhalten“.
In der Region Valencia funktionierte das Warnsystem beim jüngsten Unwetter Ende September. Das Notfall-Koordinationszentrum verschickte dieses Mal mehr als zwölf Stunden vor Eintreten der Gefahr eine Mobilnachricht mit klaren Handlungsempfehlungen: Es gelte, Reisen zu vermeiden, sich von Wasserstraßen fernzuhalten und Erdgeschosse und Garagen zu verlassen.
„Wir sind jedes Mal super nervös, wenn so eine Meldung kommt“, sagt Mila Tamarit, eine der 50.000 Demonstrierenden, die am vergangenen Wochenende in Valencia erneut gegen die Regionalregierung protestierten. „Du weißt ja nie, wo genau das Wasser runterkommt.“
Mängel beim Städtebau
Greenpeace Spanien lobt die Fortschritte im Frühwarnsystem. Die Umweltschützer kritisieren allerdings, dass städtebaulich zu wenig getan werde, um dramatische Überschwemmungen künftig zu verhindern.
Agraringenieur Eduardo Rojas Briales von der polytechnischen Universität Valencia kennt die Windungen und die Bodenbeschaffenheit des Poyo-Grabens gut. Sein Institut berät die Regionalregierung beim Wiederaufbau. Seine erschütternde Erkenntnis am Rande einer Tour entlang des Grabens: „Wenn die gleiche Menge Wasser hier erneut durchschießt, würde dasselbe passieren wie vor einem Jahr. Die eigentlichen Probleme konnten noch nicht angegangen werden.“
Dafür seien komplexe Maßnahmen nötig, deren Umsetzung vier bis fünf Jahre dauern könnten, Überschwemmungsgebiete flussaufwärts etwa. Damit könnte man verhindern, dass erneut so viel Wasser bis zu den Vorstädten gelangt.
Im dicht besiedelten Paiporta, wo die Menschen mit Kerzen der Opfer gedachten, sieht Rojas Briales die baulichen Möglichkeiten als begrenzt an. Der Graben sei schon fast bis zum Grundwasserspiegel ausgehoben. Dennoch lohne es sich, wo immer Platz ist, kleine grüne Inseln zu schaffen. Grünflächen, in denen Wasser versickern kann.
Staatshilfen für Wiederaufbau
Noch sind die Bagger im Poyo aber damit beschäftigt, Schäden zu beseitigen oder Brücken wieder aufzubauen. Rechts und links des Grabens in den Wohngebieten scheint dagegen der Alltag zurückgekehrt zu sein. Mehr als acht Milliarden Euro haben Staat und Versicherungen für Wiederaufbau und Schadensbehebung bisher bereitgestellt. Menschen konnten ihre Häuser renovieren, bekamen Geld für weggespülte und zerstörte Autos.
Dennoch ist längst nicht alles, wie es war. Kinder werden noch in Containern unterrichtet. Viele Tiefgaragen sind weiter geschlossen. Zu groß sind die Schäden, die der Schlamm in Kanalisation und Elektrik hinterlassen hat. Auch hunderte Fahrstühle sind noch außer Betrieb. Immobile Menschen, die in den oberen Stockwerken leben, kommen kaum aus ihren Häusern.
An der EAE Business School in Barcelona hat Marina Mettera die Auswirkungen der Flutkatastrophe auf Wirtschaft und Gesellschaft untersucht. „Wir sind als Gesellschaft nicht auf so große Auswirkungen auf materieller, psychologischer und wirtschaftlicher Ebene vorbereitet“, so ihre Diagnose. „Erst recht nicht auf die indirekten Auswirkungen, etwa den Stillstand des Konsums oder darauf, dass Menschen keine Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu erreichen.“
Mettera sieht in dem Ereignis einen „Weckruf“, nicht nur für die Region Valencia. Notfallpläne für Klima-Ereignisse müssten viel umfassender sein als bisher gedacht und auch soziale oder gesundheitliche Folgen einbeziehen.
Staatsakt für die Opfer am Jahrestag
Rund um den Jahrestag wird in der „Zona cero“ vieles wieder hochgespült – die Trauer um insgesamt 237 Opfer, der Großteil rund um Valencia, und die Wut über die Politik, die spät gewarnt und zu langsam geholfen hat. Bis heute streiten sich Zentral- und Regionalregierung darüber, wer woran Schuld hat und wer wofür zuständig ist. Auch beim Schutz vor weiteren Katastrophen.
Am Abend haben Angehörige gemeinsam mit Königspaar, Ministerpräsident und Regionalpräsident der Opfer gedacht. Ein würdiger Staatsakt, aber keine Versöhnung.